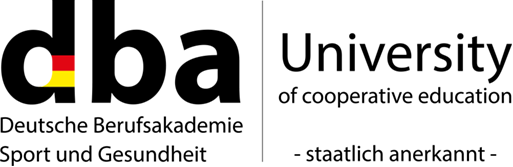Sportverletzungen – (k)eine traumatische Erfahrung?
Dr. Sabine Nunius
Professionelle Einschätzung der Situation und individualisierte Unterstützung für Betroffene
Experiencing an injury is one of the most traumatic things to happen to an athlete, yet no athlete is immune to injury despite experience or ability.
[Eine Verletzung ist eine der traumatischsten Erfahrungen, die Sportler machen können – gleichzeitig ist kein Sportler vor einer Verletzung gefeit.][1]
Glücklicherweise trifft dieses Statement von Diana Lattimore nicht auf alle Fälle zu und viele Verletzungen im Sportbereich verlaufen ohne begleitendes oder nachfolgendes Trauma. Dennoch liegt Lattimore eindeutig richtig damit, dass eine Verletzung bei Sportler:innen nicht nur Auswirkungen auf die physische Ebene haben kann. Vielmehr sind oft der mentale Bereich und das soziale Umfeld ebenfalls betroffen. Verletzte Athlet:innen sind somit auf einer Vielzahl von Ebenen beeinträchtigt und in ihrem gesamten Wohlbefinden eingeschränkt.
Sportverletzungen – ein (traumatisches) Alltagsphänomen?
Die Techniker Krankenkasse geht davon aus, dass sich pro Jahr rund 2 Millionen Menschen beim Sport verletzen. In Anbetracht dieser Zahlen lohnt sich ein genauerer Blick auf die Faktoren, die dazu führen können, dass eine Verletzung physische wie psychische Spuren hinterlässt. Schnell fällt in diesem Kontext der Begriff des Traumas. Doch: Kann eine Sportverletzung ein Trauma darstellen? Und wenn ja: Unter welchen Umständen?
Sicherlich ist nicht jede Verletzung automatisch ein Trauma oder geht mit einem Trauma einher. Leider kann dieser Eindruck leicht entstehen, da der Traumabegriff in den letzten Jahren zunehmend inflationär gebraucht wird, etwa wenn alltagssprachlich bereits ein misslungener Haarschnitt oder ein Restaurantbesuch mit ungenießbarem Essen als traumatische Erfahrung bezeichnet wird. Diese Trivialisierung birgt die Gefahr, dass Traumatisierungen im klinischen Sinn nicht mehr als solche anerkannt und ernst genommen werden.
Umgekehrt folgt die Trauma-Definition vieler gängiger medizinischer Klassifikationssysteme sehr strikten Kriterien. Die ICD-10, das in Deutschland genutzte System zur Verschlüsselung medizinischer Diagnosen, definiert Traumata als Ereignisse, die objektiv „mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß“ einhergehen und subjektiv „bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würden“ (ICD-10). Diese enge Definition mit der Voraussetzung einer objektiv außergewöhnlichen Bedrohungssituation oder einem katastrophenartigen Ausmaß dürfte – glücklicherweise – nur auf die Minderheit von Sportverletzungen zutreffen.
Gerade für den Sportbereich hat sich eine Perspektive zwischen beiden Polen als hilfreich erwiesen. Zielführend ist dabei ein Ansatz, der die subjektive Komponente des Erlebens in den Mittelpunkt rückt: „Maßgeblich für das Ausmaß des aufgrund eines Unfallgeschehens erlebten psychischen Stresses und damit auch der Art möglicher psychogener Unfallfolgen ist nicht das objektive Unfallereignis an sich, sondern das subjektive Erleben des Traumas.“[2]
Die hohe Relevanz dieser subjektiven Komponente wird offensichtlich, wenn man die Charakteristika von Sportverletzungen und ihre Auswirkungen auf die Betroffenen analysiert.
Spezifika von Sportverletzungen und ihre Auswirkungen auf Betroffene
Die Häufigkeit einer bestimmten Verletzung ist stark sportartspezifisch. Dennoch lässt sich der Großteil der Verletzungen einer der nachfolgenden Kategorien zuordnen: Schürf- und Platzwunden, Gelenkverletzungen, Gehirnerschütterungen, Prellungen, Verletzungen von Muskeln, Bändern und Sehnen sowie Knochenbrüche. Es handelt sich somit oft um Verletzungen, die mit (großen) Schmerzen und erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen. Meistens sind diese jedoch nicht lebensbedrohlich und heilen in der Regel auch so weit aus, dass zumindest eine Teilfunktionalität wieder hergestellt ist. Dennoch kann die mentale Belastung, die daraus resultiert, ganz erheblich sein.
Am besten fassbar ist dieses Phänomen am Beispiel des Spitzen- und Leistungssports. Hier kann, je nach Zeitpunkt des Geschehens, eine Verletzung einen beträchtlichen Einschnitt darstellen oder im Einzelfall sogar das Karriereende bedeuten. Für einen Kraftsportler oder Basketballer bedeutet unter Umständen bereits „nur“ ein gebrochenes und/oder nicht mehr vollständig belastbares Handgelenk das Karriereaus. Von einem Tag auf den anderen ist damit die Ausübung des bisherigen Berufs nicht mehr möglich. In Sportarten mit hochdotierten Verträgen und großer medialer Aufmerksamkeit dürften in der Regel zumindest die unmittelbaren finanziellen Folgen für die Betroffenen keine existenzielle Bedrohung darstellen. Zudem ist im Spitzensport die Gesamtversorgung der Athleten durch ein Team an hochqualifizierten Spezialisten aus den unterschiedlichen Bereichen meist gewährleistet. Weitaus schwieriger gestaltet sich die Situation dagegen in den sogenannten Randsportarten, wo weitaus geringere Summen für die Betreuung der Athlet:innen zur Verfügung stehen und eine Vielzahl von Aufgaben sozusagen in Personalunion von einem einzigen Trainer oder einem kleinen Kreis von Betreuern übernommen werden muss.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Herausforderung an Betroffene, das eigene Selbstbild möglicherweise neu definieren zu müssen. In meiner eigenen Zusammenarbeit mit Sportler:innen konnte ich über die Jahre beobachten, dass dies auch oder gerade auf den ambitionierten Hobbysport zutrifft. Hier kommen oft zwei Aspekte besonders zum Tragen. Zum einen fällt über den Sport eine wichtige „coping strategy“ weg, um beispielsweise Stress abzubauen. Zum anderen sehen sich viele nicht mehr als Sportler, wenn sie keine Leistung mehr erbringen können. Nicht selten fallen in Gesprächen Begriffe wie „Loser“ oder „Lusche“ und es kommt zu Aussagen wie „ich bring’s halt einfach nicht mehr“. Welche Auswirkungen eine solche Selbstwahrnehmung dauerhaft auf die Psyche hat, dürfte offensichtlich sein.
Verstärkt wird diese Problematik dadurch, dass im Sport ein besonderer Fokus auf Aspekten wie Leistungsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Disziplin und Stärke liegt. Nicht wenige kompetitiv aktive Sportler:innen definieren sich über genau diese Fähigkeiten und Qualitäten. Erleiden diese Athlet:innen eine Verletzung, sehen sie sich mit einer ganz anderen Situation konfrontiert. Sie können die Umstände nur noch in sehr geringem Umfang selbst beeinflussen und nehmen sich selbst als schwach, hilflos und ohnmächtig wahr. Zusätzlich fallen durch die Verletzung positive Erfahrungen und Bestätigung in Form von Wettkampferfolgen weg, was das Selbstwertgefühl zusätzlich beeinträchtigen kann.
Befeuert werden derartig negative Gedanken leicht dadurch, dass plötzlich sehr viel Zeit zum Grübeln vorhanden ist. Unter Normalbedingungen sind im Leistungssport stark strukturierte und umfangreiche Trainingspläne die Regel – der Alltag der meisten Sportler:innen ist komplett durchgetaktet. Diese Routine fällt bei einer Verletzung weg. Viele Sportler:innen stürzen so von einem Extrem ins andere. Während zuvor kaum freie Zeit für selbstgewählte Aktivitäten blieb, herrscht nun ein Übermaß an ungefüllter Zeit – und damit auch (zu viel) Raum für Grübeln und belastende Gedanken.
Erschwerend kommt hinzu, dass innere Unruhe und eine gedrückte Stimmung durch physische Prozesse verstärkt werden können. Denn eine Verletzung bremst die Betroffenen auch in körperlicher Hinsicht schlagartig komplett aus. Aus dem Leistungssport wissen wir, wie wichtig ein dosiertes Herunterfahren der Belastung ist, um derartige Phänomene zu vermeiden – Stichwort gezieltes Abtrainieren nach Karriereende. Bleibt dieses aus, haben Sportler:innen meist mit diversen negativen Folgen zu kämpfen. Bei einer schweren Verletzung steht Betroffenen diese Option allerdings überhaupt nicht offen. Sie können schlichtweg die Belastung nicht in der Weise reduzieren, die gerade optimal und an ihren vorherigen Leistungsstand angepasst wäre. Die daraus resultierenden Folgen sind vergleichbar mit den Symptomen, die bei unzureichendem Abtrainieren auftreten. Neben Muskelschmerzen und unangenehmen Spannungszustände umfassen diese auch psychosomatische Beschwerden. Letztere sind unter anderem ausgelöst durch die fehlende Ausschüttung bestimmter Hormone, insbesondere Endorphin, Dopamin und Serotonin. Ihr Fehlen kann den Sportler oder die Sportlerin förmlich in ein Loch fallen lassen und zu schlechtem Schlaf, Kopfschmerzen und innerer Unruhe führen.
Niederschwellige Unterstützungsangebote und effektive Hilfestellungen
Was lässt sich also tun und wie können Betroffene unterstützt werden? Zunächst gilt es, möglichst frühzeitig zu erkennen, ob eine Traumatisierung vorliegt und Unterstützung notwendig ist. Das jeweils benötigte Maß an Unterstützung ist von einer Vielzahl individueller Faktoren abhängig. Dazu zählen beispielsweise das Alter (Erwachsene vs. Jugendliche), sozio-ökonomischer Status, finanzielle Absicherung, Einbindung in ein stabiles soziales Umfeld, bereits bestehende Unterstützung, etc. Außer Frage steht, dass natürlich stets die Wünsche der Betroffenen selbst berücksichtigt werden müssen – leider ist dies nicht immer der Fall. Gerade wenn zuvor noch keine oder wenig Berührungspunkte zu Themen wie mentaler Belastung und Psychotherapie bestanden, kann es den oder die Einzelne(n) erhebliche Überwindung kosten, eine solche Beratung und anschließende Therapie überhaupt in Anspruch zu nehmen. Hinzu kommt das (vermeintliche oder reale) Risiko einer Stigmatisierung durch eine psychiatrische Diagnose. Gerade hier ist ein vertraulicher Umgang mit allen Informationen unabdingbar und sollte in jedem Fall gewährleistet sein.
Bei der konkreten Unterstützung besteht wie erwähnt ein wichtiger erster Schritt darin zu erkennen, ob eine Traumatisierung vorliegt. Hier hilft Wissen in Form von Psychoedukation. Das bedeutet, dass die Betroffenen Informationen darüber erhalten, wie sie die erlebten Symptome einordnen können und welche Behandlungsoptionen sich bieten. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die Sensibilisierung der Trainerschaft. Idealerweise erkennen die betreuenden Trainerinnen und Trainer schon erste Anzeichen und sind so in der Lage, professionell zu reagieren und zu entscheiden, auf welchem Level und in Kooperation mit welchen Fachleuten eine weitere Unterstützung möglich und notwendig ist. Im Zweifelsfall muss dabei natürlich stets ein entsprechend qualifizierter Therapeut bzw. eine Therapeutin hinzugezogen werden. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von Hinweisen, die bereits für aufmerksame Beobachter erkennbar sind.
Hilfreich hierbei ist eine von der National Collegiate Athletic Association zusammengestellte Liste[3] mit möglichen Symptomen:
Dauerhafte Symptome
- Verändertes Essverhalten/Appetit
- Schlafstörungen
- Reizbarkeit
Stärker werdende Symptome
- Veränderungen des Essverhaltens in Richtung einer Essstörung
- Niedergeschlagenheit bis hin zur Depression
- Motivationsmangel bis hin zur Apathie
- Rückzug bis hin zur Entfremdung
Stark ausgeprägte Symptome
- Verbale und nonverbale Verhaltensweisen, die auf ein hohes Schmerzlevel hinweisen
- Übermäßige Wut oder Ärger
- Häufiges Weinen oder emotionale Ausbrüche
- Substanzmissbrauch
Dieser Überblick schafft einen soliden Ersteindruck und versetzt Betreuerinnen und Betreuer in die Lage, die mentale Belastung ihrer Coachees nach einer Verletzung besser einzuschätzen.
Ein zweiter wichtiger Baustein ist ein Grundwissen über mögliche Symptomverläufe. Hier ist es wichtig zu wissen, dass bestimmte Phänomene erst mit einem gewissen zeitlichen Verzug auftreten können:
- Emotionale Reaktionen variieren stark in Abhängigkeit von der zeitlichen Distanz zur Verletzung.
- Die Zeitprofile verschiedener Emotionen besitzen möglicherweise unterschiedliche Muster. Während zum Beispiel Langeweile offensichtlich linear ansteigt, ergeben sich für Frustration Hinweise auf U-förmige Verläufe.
- Extreme, klinisch relevante Stimmungsstörungen (vor allem Depressionen) treten vermutlich bei 10–20 % der Sportverletzten auf.[4]
Mit diesem Wissen und eventuellen weiteren Therapie- und Behandlungsangebote ist es möglich, Betroffene zu unterstützen und gemeinsam einen Plan für die nächsten Schritte auszuarbeiten. Wie dieser konkret in der Praxis aussieht, ist von Fall zu Fall verschieden. Grundsätzlich erfolgsversprechend sind jedoch Ansätze, bei denen realistische Ziele gesetzt werden, ein vertrauensvoller Umgang miteinander stattfindet und Maßnahmen kombiniert werden, die sowohl die physische als auch die psychische Dimension einbeziehen.
[1] In: Lattimore, Diana. (2017). On the sidelines: An athlete’s perspective of injury recovery. Sport & Exercise Psychology Review. 13. 13-21.
[2] In: von Hagen C. (1995) Psychische Verarbeitung von Verletzungen aus der Sicht der Psychologie. In: Hierholzer G. et al. (eds) Gutachtenkolloquium 10. Springer, Berlin, Heidelberg
[3] http://www.ncaa.org/sport-science-institute/mind-body-and-sport-how-being-injured-affects-mental-health, abgrf. 17.02.2022.
[4] Kleinert J. 2002. Das Stress-Wiederverletzungs-Modell: psychologische Ansätze zur Erklärung und Vermeidung von Wiederverletzungen im Sport. Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin und Sporttraumatologie». 50 (2): 49–57.