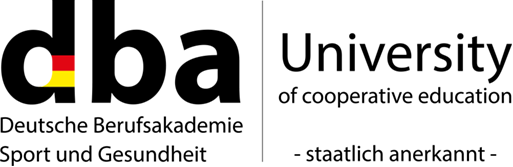Tracker, Apps und Analyse-Tools – wieviel Technik braucht das Training?
Dr. Sabine Nunius
Sinnvolle Trainingsunterstützung oder Modeerscheinung mit Potenzial zur Totalüberwachung? Was technische Hilfsmittel leisten können und warum wir sie mit Bedacht einsetzen sollten
„Gibt’s dafür nicht auch eine App?“, „Das habe ich alles schon mit meiner Smartwatch getrackt“ oder „Ich mache das jetzt komplett digital, ohne Coach“ sind Aussagen, die man noch vor 10 Jahren so gut wie nie gehört hat. Spricht man jetzt im Coaching mit neuen Klienten, ist es dagegen fast schon Standard, dass die zu betreuenden Athleten über (mindestens) ein Gadget verfügen. Manche Sportlerinnen und Sportler besitzen sogar ein wahrhaftes Arsenal an Fitnesstrackern und anderem Equipment, mit denen sie täglich eine schier überwältigende Menge an Daten aufzeichnen, analysieren und für die Zukunft abspeichern. Wie weit ist dieser Trend bereits verbreitet? Und wie sinnvoll ist diese Tendenz zu immer mehr Technik, immer weiterführender Auswertung und immer größeren Datensammlungen?
Betrachtet man die aktuellen Zahlen, wird schnell deutlich, dass die Nutzung von Apps und Co. inzwischen alles andere als ein Ausnahmephänomen ist. Besonders sticht in diesem Zusammenhang der Bereich der Fitness-Apps heraus. Diese erleben gerade einen veritablen Boom. Statista prognostiziert in diesem Segment sogar noch weiteres Wachstum und geht von folgenden Zahlen aus:
- Umsatz 2025: ca. 7,56 Mrd. Euro
- Marktvolumen 2029: 9,16 Mrd. Euro (= jährliches erwartetes Umsatzwachstum von 4,92 % (CAGR 2025-2029))
- Penetrationsrate 2025: 12,21 % Anstieg auf 13,21 % bis 2029
- Durchschnittlicher Erlös pro Nutzer (ARPU, engl. Average Revenue Per User): 18,94 Euro[1]
Diese Schätzungen sprechen eine deutliche Sprache. Der Trend geht ganz klar zu mehr Digitalisierung und technikgestütztem Training. Doch was genau leisten die Apps eigentlich? Und wofür werden sie eingesetzt? Betrachtet man die Inhalte genauer, liegen aktuell Sport-Apps an der Spitze, die Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen aufzeichnen, gefolgt von Apps mit Fitness-Übungen für zuhause sowie Apps zum Thema Gewicht und Ernährung. Auf Platz 4 liegen Apps, die ausschließlich Körperdaten messen, zum Beispiel die Schlafqualität, die Herz- oder Atemfrequenz.[2] Diese Anwendungen erfreuen sich offensichtlich großer Beliebtheit und werden mit Abstand am häufigsten genutzt, um die entsprechenden Daten zu sammeln. Laut Statista standen im Jahr 2024 den rd. 18,31 Millionen App-Nutzern lediglich 6,66 Millionen Nutzern von sogenannten „Wearables“ gegenüber.[3]
Aber was bringt diese Vielzahl an Apps, Anwendungen und Geräten? Der momentane Hype dürfte zunächst vor allem die Industrie freuen. Denn in der umkämpften Fitnessbranche bieten allen voran die Apps einen Bereich mit enormem Wachstumspotenzial, was in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders attraktiv ist. Dieses Potenzial erwächst nicht zuletzt daraus, dass es sich bei den Apps nicht nur um ein B2C (Business-to-Customer) Geschäftsmodell handelt. Vielmehr wird beispielsweise auch prognostiziert, dass sich die Konzepte von Fitnessstudios grundlegend verändern könnten, um auf die neuen Rahmenbedingungen zu reagieren – eine Entwicklung, die die Hersteller der entsprechenden Produkte tatkräftig unterstützen. Beworben wird die Ausrichtung hin zu mehr Digitalisierung mit dem Versprechen, dass Apps es künftig ermöglichen sollen, individuellere Pläne und Angebote zu kreieren. Auf diese Weise wird, so das Werbeversprechen, neben einer verbesserten Betreuung auch die Kundenbindung verstärkt.
Eine individuellere und optimierte Betreuung ist für den Einzelnen sicherlich von Vorteil. Ebenso ist eine stärkere Kundenbindung grundsätzlich nicht schlecht oder zumindest unproblematisch. Deutlich nachdenklicher stimmt dagegen eine „Begleiterscheinung“ dieser Entwicklung, die aus gutem Grund deutlich zurückhaltender kommuniziert wird. Dabei handelt es sich um die Tatsache, dass mit Hilfe der Apps Datenmengen in bislang kaum vorstellbarem Umfang erzeugt und für diverse Zwecke genutzt werden können. Häufig werden diese Daten von den Nutzern der Apps sogar bereitwillig zur Verfügung gestellt: Kaum jemand setzt sich gerne mit dem Kleingedruckten auseinander. Gerade dann, wenn es schnell gehen soll, weil man ein Programm nutzen möchte, sind rasch ein paar Häkchen gesetzt oder Klicks gemacht, bei denen man im Nachhinein vielleicht gar nicht einmal mehr so genau weiß, was oder wem man gerade zugestimmt hat und welche Konsequenzen dies haben könnte. Die allgegenwärtigen Cookie Banner haben sicherlich zu einer gewissen Desensibilisierung beitragen. In der Regel ist es unmöglich, eine Website zu nutzen, ohne zumindest den „notwendigen“ Cookies zugestimmt zu haben. Die Schwelle, an anderer Stelle ebenso irgendeiner Datennutzung zuzustimmen, sinkt daher, selbst wenn es sich um sensible Daten wie Gesundheitswerte, Bewegungsprofile und persönliche Angaben zu den eigenen Lebensgewohnheiten handelt.
Die Website „Externer Datenschutzbeauftragter DSB-TÜV“ beschreibt die Konsequenzen am Beispiel der vielgenutzten Apple Watch wie folgt: „APPLE WATCH verfügt über diverse Sensoren bzw. bedient sich der des iPhones, wertet aus, zeichnet auf und stellt diese Daten optional anderen APPs auf dem iPhone zur Verfügung. In der Produktbeschreibung der APPLE WATCH heißt es wie folgt – „…können Gesundheits- und Fitnessapps anderer Anbieter darauf zugreifen – wenn du das willst…“. Auf den Punkt gebracht, die Kommunikation der APPLE WATCH findet zwar nur mit dem iPhone des Nutzers – dem Träger der Apple Uhr – statt und sollte somit sicher sein. Was passiert jedoch in der APP des Drittanbieters, wo speichert diese APP dann Ihre sensiblen Gesundheitsdaten – und was wertet diese APP aus, stellt sie daraus Rückschlüsse her und nutzt diese Ergebnisse in welcher Form – Fragen über Fragen…“[4] Ebenso wird darauf hingewiesen, dass bei Aktivierung der entsprechenden Funktionen eine Dauerüberwachung inkl. Bewegungsprotokoll möglich ist: „Ob auf dem Gang zur Toilette, beim Spaziergang mit dem Hund, auf dem Weg zur Arbeit die körperlichen Belastungen werden zeitlich und in Verbindung mit dem iPhone bis auf den Meter genau aufgezeichnet. Nicht nur während der sportlichen Aktivitäten, beim Tischtennis, Joggen oder Fahrradfahren ist die Datenerfassung aktiv – nein auch in für die Bewertung der Fitness unzuträglichen Situationen.“[5] Dieser Tatsache sollte man sich zumindest bewusst sein, wenn man sich dafür entscheidet, einen Fitnesstracker zu nutzen und diesen mit diversen Apps auszustatten oder eine Kopplung zuzulassen.
Spielzeug für die Hippen, Coolen, Stylishen? Nutzergruppen genauer betrachtet
Doch wer nutzt eigentlich die Apps? Aufschlüsse darüber gibt die Studie „Germany in Motion“ der GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung. Sie untersuchte die unterschiedlichen Zielsetzungen und Motivationsgründe, Sport zu treiben und erstellte auf dieser Basis eine Typologie verschiedener Nutzerkreise. Hinsichtlich der Nutzer von digitalen Hilfsmitteln dürfte vor allem der „Fit2Share“ Typus relevant sein, der wie folgt beschrieben wird: „Die Digital-Junkies treiben zwei bis drei Mal in der Woche Sport und geben viel für Equipment und speziell Ernährung aus […]. Die Social-Media affinen Sportler sind auf Instagram oder Youtube zu Hause und nutzen Fitness-Apps als Informationsquelle oder auch als virtuellen Ersatz für einen Trainer im Fitness-Studio. Und die sportlichen Erfolge werden natürlich mit der Community geteilt. Die Fit2Share-Gruppe unterscheidet sich stark von den anderen Freizeitsportlern. Bei ihr stehen klassische Sportmotive nicht im Vordergrund, nur 45 Prozent dieses Segments gaben an, Spaß am Sport zu haben“.[6] Das Potenzial, das diese Nutzergruppe bietet, haben in der Branche einschlägige Unternehmen ganz klar erkannt. So gibt etwa Les Mills an „80 % der Fitnessstudiobesucher sind Millennials oder gehören der Gen-Z an – der so genannten „Generation Active. 89 % der Nutzer von Online- bzw. App-Workouts gehören der „Generation Active“ an.[7]
Geködert werden diese Nutzer mit immer neuen Funktionen, oft auch in Verbindung mit Elementen, die auf „Gamification“ setzen. Dabei rückt das eigentliche Training mitunter fast in den Hintergrund. Aspekte wie „Gesundheit“, „Spaß an der Bewegung“ und „sinnvolle Verbesserung der eigenen Technik und sportlichen Leistung“ stehen dann zurück hinter Rankings bei diversen Challenges, dem Sammeln von Bonuspunkten oder der Ausweitung der eigenen „Community“ durch das Hinzugewinnen von „Followern“. Häufig werden dabei die konkreten Inhalte der Apps und Anwendungen – egal ob es um Ernährung, Training oder den generellen Lifestyle geht – kaum oder gar nicht hinterfragt. Getan wird das, was die App vorgibt oder das Programm als notwendig verkauft. Diese Entwicklung ist durchaus bedenklich, da einige der Fitness-Challenges, die momentan im Trend sind, vor allem bei Einsteigern eindeutig zu Überlastungen führen. Ebenso grassieren Ernährungstipps, die auf extremen Ernährungsformen wie z. B. einer ketogenen Diät basieren und keineswegs für jeden Sportler geeignet oder sinnvoll sind. Im Gegensatz zum Training im Studio oder mit einem Coach gibt es bei den Apps zudem in aller Regel keinerlei Beratung oder irgendeine Art von ausgleichendem Korrektiv, was gerade die Nutzung durch unerfahrene Sportler problematisch macht.
Anders als das Klischee nahelegt, sind die technik- und social media-affinen Youngsters, denen es vor allem um Außenwirkung geht, jedoch keineswegs die einzige Nutzergruppe. Laut dem Deutschen Ärzteblatt erfreuen sich neben den Fitness- auch Gesundheits-Apps immer größerer Beliebtheit: „Sie unterstützen Patientinnen und Patienten niedrigschwellig etwa bei Übergewicht, Diabetes oder psychischen Problemen. In Deutschland nutzt fast jeder Dritte (31,6 Prozent) einer Civey-Umfrage aus dem vergangenen Jahr zufolge eine solche Anwendung. […] Zu Gesundheits-Apps gehören medizinische Apps wie beispielsweise die deutschen digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Die Mehrheit der Apps seien allerdings unregistrierte Wellness-, Sport- oder Lifestyle-Apps, erklärt Müllerová. Rund 22 Prozent aller verfügbaren Gesundheits-Apps zielten auf die mentale Gesundheit.[8] Ein großer Vorteil dieser Art von Anwendung liegt ganz eindeutig darin, dass eine weitaus striktere Qualitätskontrolle erfolgt und davon ausgegangen werden darf, dass zumindest die DiGAs auf aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien und Empfehlungen beruhen. Dennoch stellt sich die Frage, wie weit eine technische Anwendung die individuelle Betreuung und Beratung wirklich ersetzen kann oder ob es sich vielmehr um eine Ergänzung handeln sollte. Hier ist zu bezweifeln, dass die Apps, zumindest in der aktuellen Form, wirklich eine umfassende Betreuung leisten können, vor allem dann, wenn es um komplexere Fragestellungen geht. Ein Aspekt, der ganz klar positiv heraussticht, ist dagegen die Datensicherheit: „Damit Patientinnen und Patienten solche Anwendungen sicher nutzen können, werden sie vom BfArM u. a. auf die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen geprüft. Wenn dabei Mängel auffallen, müssen die Hersteller nachbessern.“[9]
Mehr Leistung, Motivation und Wohlbefinden? Was die Anwendungen wirklich bringen
Angesichts der Flut an Anwendungen und Vielzahl von Nutzern stellt sich darüber hinaus die Frage, welchen Nutzen die Apps haben und wem sie letztendlich mehr dienen – der sie herstellenden Industrie in Form von Umsätzen oder den Nutzern in Form von mehr Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Ein kurzzeitiger Effekt dürfte klar sein: Durch die Installation einer App entsteht potenziell der Eindruck, sich um die eigene Gesundheit oder Fitness gekümmert zu haben und damit ein gutes Gefühl. Unter Umständen steigt anfangs zudem die Motivation, wirklich etwas zu ändern und beispielsweise Bonuspunkte zu sammeln oder eine Tagesaufgabe zu erledigen. Doch wie sieht es mittel- bis langfristig aus? Und wie stark fallen die erzielten Verbesserungen tatsächlich aus?
Erste Studienergebnisse zeichnen ein eher ernüchterndes Bild. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2021 kam beispielsweise zu dem Ergebnis, dass bei der Etablierung neuer Bewegungsgewohnheiten in Verbindung mit dem Besuch eines Fitnessstudios keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Teil-Gruppen vorlagen. Die Nutzung einer Fitness-App hatte somit keinen direkten Einfluss auf die Sportgewohnheiten der Teilnehmer der Studie. Ebenso gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem Fitnessstudio oder der Bindung an dieses spezielle Studio. Es konnte folglich gezeigt werden, dass eine Fitness-App als alleinstehendes Element offenbar nicht ausreicht, um Gewohnheiten, die Zufriedenheit oder die Absicht, bei einem Studio zu bleiben, zu verbessern.[10]
In die gleiche Richtung geht das Ergebnis einer größer angelegten Meta-Studie, die zu folgendem Schluss kam: „In elf randomisiert-kontrollierten Studien wurde untersucht, ob sich Menschen mehr bewegen, wenn sie Fitness-Apps verwenden. Hierzu bekam eine Personengruppe eine App oder eine App und einen Tracker zur Verfügung gestellt. […] Es liegt kein Hinweis darauf vor, dass die Verwendung einer Fitness-App oder eine Kombination aus Fitness-App und Tracker einen relevanten Einfluss auf das mittel- und längerfristige Ausmaß der regelmäßigen körperlichen Aktivität hat. […] Bei kurzer Studiendauer (zwei bis zehn Wochen) scheinen sich App-Benutzerinnen und -benutzer mehr zu bewegen, bei längerer Studiendauer (bis zu zwölf Monaten) ist dies jedoch nicht mehr so. Dabei bestehen keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, unterschiedlichen Altersgruppen oder Personen mit unterschiedlichem BMI.“[11]
Geht es darum, die Motivation langfristig aufrechtzuerhalten und die eigenen Gewohnheiten grundlegend zu ändern, verzeichnen die Apps – zumindest als alleiniges Mittel – somit offensichtlich keine besseren Ergebnisse als die klassische Betreuung oder andere Formen des Coachings.
Wie sieht es in anderen Einsatzbereichen aus? Hinsichtlich des Nutzens für die Steigerung der eigenen Leistung und Trainingssteuerung, darf man ebenfalls skeptisch bleiben, zumindest dann, wenn es um den flächendeckenden Einsatz geht. Im Spitzenbereich ist es sicherlich von Nutzen, auf diverse Daten zugreifen und diese auswerten zu können. Für den Hobbybereich stellt sich jedoch die berechtigte Frage, in welchem Rahmen dies tatsächlich sinnvoll ist: Wer es in der Regel ein bis maximal zwei Mal pro Woche überhaupt zum Sport schafft, hat sicherlich zahlreiche andere Stellschrauben als ausgerechnet die Optimierung der Mikronährwerte oder die exakte Bestimmung der aeroben Schwelle. Hinzu kommt, dass vielfach ein solides Wissen notwendig ist, um überhaupt mit den angezeigten Werten arbeiten zu können. In meiner eigenen Coaching-Tätigkeit erlebe ich es immer wieder, dass zwar umfassende Auswertungen und Analysecharts präsentiert werden, die Nutzer aber nicht wissen, in welcher Einheit die Werte angegeben werden, geschweige denn, was sie aussagen. Dieses Wissen wäre jedoch dringend notwendig, um entscheiden zu können, was ein „guter“ bzw. „schlechter“ Wert ist und was letztendlich zu tun wäre, um diesen Wert zu beeinflussen oder zu verbessern. Spätestens dann stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit von umfassender Datensammlung mit Nachdruck. Zudem ist zu bedenken, dass die von der Uhr oder App angezeigten Werte immer öfter unhinterfragt übernommen werden. Dabei wird die Genauigkeit der Messungen häufig überschätzt. Das wird dann problematisch, wenn Nutzer anschließend aufgrund dieser Informationsgrundlage eine ernsthafte Erkrankung oder körperliche Fehlfunktion vermuten, die unter Umständen aus einem Messfehler oder einer falschen Auswertung resultiert. Bis diese Frage geklärt ist, vergeht oft viel Zeit und es bedarf mitunter aufwändigerer Diagnostik, die wiederum mit Kosten und erheblichem psychischem Stress verbunden ist. Dieser Tatsache sollte man sich beim Einsatz diverser Analysetools unbedingt bewusst sein, vor allem dann, wenn immer mehr gesundheitskritische Daten erhoben sowie Vermutungen über das Vorliegen von Krankheiten angestellt werden.
Vorsicht ist dabei insbesondere bei Apps geboten, die sich auf die mentale Gesundheit konzentrieren, wie Dr. Petra Müllerová von der Lund Universität in Schweden darlegt: „Gerade bei Apps für die mentale Gesundheit gebe es unterschiedliche Level. Von unproblematischen Anwendungen mit Atemübungen bis hin zu dem Versprechen, Krankheiten zu diagnostizieren oder zu heilen. Hierfür braucht es aber einen Arzt oder eine Ärztin. […] Noch schwieriger werde es, wenn es um Apps geht, die Künstliche Intelligenz (KI) nutzen und Menschen mit Chatbots kommunizieren wie mit ihren Psychotherapeuten. „Da gibt es sichere, die medizinisch gestaltet und als Medizinprodukt zertifiziert sind. Andere sind allerdings nicht kontrolliert und basieren lediglich auf einer KI, die an keinen medizinischen Richtlinien aufgebaut worden ist.[12] In diesen Fällen können Apps schlimmstenfalls eindeutigen Schaden anrichten, so dass von einer Nutzung dringend abzuraten ist.
Apps als Ersatz für den Trainer?
Verfolgt man die aktuelle Diskussion wird man regelmäßig mit der These konfrontiert, dass es nun wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Coach aus Fleisch und Blut durch eine Anwendung oder künstliche Intelligenz ersetzt wird. Unbestritten ist es so, dass sich der Trainerberuf – wie wohl fast jeder andere Beruf – in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern wird. Dieses Phänomen gab es jedoch schon immer: Wohl in keinem Job bleiben die Anforderungen und dafür notwendigen Fähigkeiten über Jahrzehnte hinweg konstant gleich. Vielmehr besteht überall die Notwendigkeit zu beständiger Fort- und Weiterbildung. Was sich allerdings tatsächlich verändert hat, ist die Geschwindigkeit, mit der neue Entwicklungen eintreten. Diese zwingt uns dazu, schneller als früher auf Entwicklungen zu reagieren und Angebote entsprechend anzupassen.
Doch trotz dieser zunehmenden Beschleunigung zeichnet sich aktuell dennoch nicht ab, dass „echte“ Coaches in absehbarer Zeit komplett überflüssig werden. Ein Blogartikel der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement sieht die Betreuung durch qualifiziertes Trainingspersonal sogar weiterhin als absolute Notwendigkeit: „Fehlt es an einer individuellen Abstimmung der Trainingsparameter, einer realistischen Zielbestimmung und der Einweisung, so werden wichtige Parameter zu Abstimmung der Dosierung und Anpassung des Programmes an den Kunden übergangen. Dies kann im negativsten Falle zu einer Überlastung oder Verletzung, in den allermeisten Fällen zu einem Ausbleiben von notwendigen Trainingsreizen und damit -effekten, führen. […] Diese essenziellen Grundlagen sind durch eine professionelle Betreuung und Trainerleistung gegeben (Strohacker, Fazzino, Breslin & Xu, 2015; Mujika, Halson, Burke, Balagué & Farrow, 2018). Dies gilt nicht nur für die Trainingsprogrammerstellung, sondern im besonderen Maße für die Durchführung. Durch Feedback, motivationale Unterstützung und Trainingsbetreuung wird dies sichergestellt (Mazetti et al., 2000; McClaran, 2003).“[13]
Fakt ist also, dass „echte“ Coaches definitiv auch weiterhin ihre Berechtigung haben. Bedeutet das gleichzeitig, dass die Apps und Wearables letztendlich vollkommen überflüssig sind? Mitnichten! Ergänzend eingesetzt haben viele sicherlich ihren Nutzen und können zur Leistungssteigerung und Verbesserung des Wohlbefindens beitragen. Das funktioniert in aller Regel jedoch nur dann, wenn parallel dazu eine kompetente Betreuung stattfindet oder sehr viel eigenes Wissen vorhanden ist, um die Werte korrekt einzuschätzen, bei Problemen gegenzusteuern und Fehler zu korrigieren. Dabei ist der Blick von außen bzw. die zusätzlich hinzugezogene Expertise in vielen Fällen nach wie vor unverzichtbar.
[1] https://de.statista.com/outlook/hmo/digital-health/digital-fitness-well-being/gesundheits-wellness-coaching/fitness-apps/weltweit, abgeruf. 23.03.2025
[2] https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Fitness-Gesundheits-Apps-Smartphone, abgeruf. 23.03.2025
[3] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1046996/umfrage/marktentwicklung-von-Wearables-und-fitness-apps-in-deutschland/, abgeruf. 23.03.2025
[4] https://www.externedatenschutzbeauftragte.de/blog/apple-watch-datenschutz-medizin-apps-apple-uhr-deutschland-preis-g%C3%BCnstig-kaufen.html, abgeruf. 23.03.2025
[5] https://www.externedatenschutzbeauftragte.de/blog/apple-watch-datenschutz-medizin-apps-apple-uhr-deutschland-preis-g%C3%BCnstig-kaufen.html, abgeruf. 23.03.2025
[6] https://www.dosb.de/aktuelles/news/detail/studie-untersucht-fitness-typen-unter-freizeitsportlern, abgeruf. 23.03.2025
[7] https://www.lesmills.com/de/studios/forschung-insights/forschung/generation-active-ihre-wichtigste-zielgruppe/, abgeruf. 23.03.2025
[8] https://www.aerzteblatt.de/archiv/digitale-anwendungen-gesundheits-apps-werden-beliebter-9632442e-3e2f-465b-aab2-c8eaf7878c14, abgeruf. 23.03.2025
[9] https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/DiGA-und-DiPA/Datensicherheitskriterien/_node.html, abgeruf. 23.03.2025
[10] Valcarce-Torrente M, Javaloyes V, Gallardo L, García-Fernández J, Planas-Anzano A. Influence of Fitness Apps on Sports Habits, Satisfaction, and Intentions to Stay in Fitness Center Users: An Experimental Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 2;18(19):10393. doi: 10.3390/ijerph181910393. PMID: 34639692; PMCID: PMC8507994.
[11] https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/wissen/mehr-bewegung-aber-wie/verhelfen-fitness-apps-zu–mehr-bewegung, abgeruf. 23.03.2025
[12] https://www.aerzteblatt.de/archiv/digitale-anwendungen-gesundheits-apps-werden-beliebter-9632442e-3e2f-465b-aab2-c8eaf7878c14, abgeruf. 23.03.2025
[13] https://www.dhfpg.de/newsroom/fachartikelfachnews/details/fitness-apps-als-trainerersatz, abgeruf. 23.03.2025