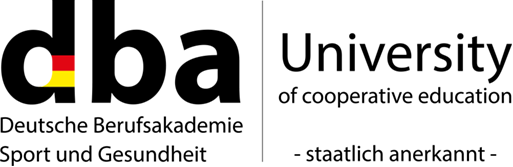Zwischen Ideal und Identität: Wenn Training kippt – Körperbildstörungen, gestörtes Essverhalten und mentale Risiken im Training
Daniel Schoon
Training, Sport und Fitness stehen für mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude. Doch zwischen Trainingsroutinen, Körperidealen und Selbstoptimierung kann die Grenze zwischen gesundem Ehrgeiz und gefährlicher Obsession verschwimmen. Immer mehr Fitnesstreibende und Trainierende geraten in eine Abwärtsspirale aus restriktivem Essverhalten, zwanghaftem Training und verzerrter Selbstwahrnehmung. Der Wunsch nach einem definierten Körper kann unbemerkt in Essstörungen und Körperbild bezogene Störungen münden.
Moderne Fitnessideale, Diättrends und soziale Medien verstärken diesen stillen Druck:
Der ständige Vergleich mit bearbeiteten Körperbildern, moralische Botschaften rund um Disziplin und Ernährung („Clean Eating“) sowie ein zunehmend Ästhetik orientiertes Gesundheitsverständnis begünstigen laut Arbeiten Körperunzufriedenheit, Essstörungsproblematiken und Kontrollverhalten. Untersuchungen auf neurophysiologischer Ebene zeigen zudem, dass extremes Streben nach dem perfekten Körper mit Mustern im Gehirn einhergeht, wie sie auch bei Zwangsstörungen oder funktionalen Suchterkrankungen beobachtet werden [1,2,3,4,6].
Der folgende Artikel betrachtet nicht nur die zentralen Formen und Risiken solcher Störungen, sondern gibt auch praktische Tipps & Hacks zur Prävention und Früherkennung im Trainingsalltag.
Neue Ideale: Der stille Druck in der Trainingswelt
Körperliches Training, Sport sowie Fitnesstreiben waren lange Zeit nur mit positiven gesundheitlichen Effekten verbunden – sowohl physisch als auch mental.
Fitness stand für Gesundheit, Belastbarkeit, Ausdauer und auch soziale Integration. Heute hingegen wird körperliche Fitness in großen Teilen der Gesellschaft zunehmend über verschiedene Hebel ästhetisch aufgeladen. Visuelle Ideale wie „Shredded“, „Toned“ oder „Beach Body“ setzen sich über soziale Medien und Werbekanäle durch und erzeugen einen stillen, aber allgegenwärtigen Anpassungsdruck, dies unabhängig vom tatsächlichen Gesundheitszustand.
Diese Entwicklungen bleiben leider nicht ohne Folgen:
Zahlreiche Studien und Arbeiten belegen, dass der Konsum idealisierter Körperbilder auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube mit erhöhter Körperunzufriedenheit, gestörtem Essverhalten und einem niedrigeren Selbstwertgefühl korreliert – besonders bei jungen Erwachsenen und Personen mit geringer Selbstwirksamkeit [2,6]. Die ständige Sichtbarkeit vermeintlich perfekter Körper fördert Vergleichsprozesse, die psychologisch als maladaptiv(unangepasst) gelten: Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, das eigene Erscheinungsbild als defizitär, also mit Mängeln wahrzunehmen, selbst wenn objektiv keine Abweichung vorliegt.
Hinzu kommt eine leider zunehmende Kommerzialisierung der Fitnesskultur: Durch falsche sowie undifferenzierte Coaching-Angebote, Ernährungssysteme, Supplemente oder personalisierte Trainingspläne wird ein Ideal verkauft, das selten erreichbar und biologisch oft nicht nachhaltig ist. Die Definition von Fitness verschiebt sich dabei – weg von funktionaler Leistungsfähigkeit, hin zu optischer Übereinstimmung. Wer nicht definiert, schlank oder muskulös genug erscheint, empfindet sich selbst als „nicht fit“, auch wenn Kraft, Ausdauer oder Gesundheit objektiv vorhanden sind.
Besonders problematisch:
Diese Körperideale wirken nicht selektiv, sondern beeinflussen Menschen aller Alters- und Zielgruppen. Neubauer et al. (2022) zeigt, dass sich selbst erfahrene Sportlerinnen mit durchtrainierten Körpern im Vergleich zu medial vermittelten Bildern als „unzureichend“ wahrnehmen – eine Folge internalisierter Ideale und weiterer sozialer Bewertungsmechanismen sowie Abstufungen. Die Autorin betont, dass insbesondere Frauen unter dem Druck stehen, gleichzeitig schlank und trainiert bzw. muskulös zu erscheinen – ein Widerspruch, der häufig in restriktivem Essverhalten, Trainingszwang und psychischer Belastung mündet.
Auch Männer sind betroffen:
Das Streben nach sichtbarer Muskelmasse ist nicht nur ein ästhetisches Ziel, sondern oft ein Versuch, sozialen Erwartungen nach Stärke, Dominanz oder Selbstkontrolle zu entsprechen. Der Adonis-Komplex, wie er im nächsten Abschnitt thematisiert wird, spiegelt dies besonders wider.
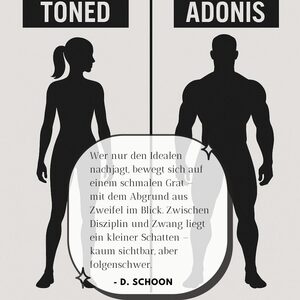
All dies führt zu einer Verzerrung der Fitnessdefinition: Statt die individuelle Gesundheit und Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, dominieren zunehmend äußerlich sichtbare Marker wie Körperfettanteil, Sixpack oder Symmetrie. Funktionale Parameter wie Regeneration, Gelenkgesundheit, mentale Ausgeglichenheit oder Alltagstauglichkeit treten leider in den Hintergrund.
Für die Praxis bedeutet das: Trainer:innen, Fachkräfte und Gesundheitsanbieter müssen Körperbilder kritisch hinterfragen und Training wieder als Werkzeug für Selbstwirksamkeit, Lebensqualität und Gesundheitsförderung positionieren – nicht als Bühne für Selbstinszenierung und Vergleich.
Zwischen Adonis und Toned Ideal: Geschlechtsspezifische Fallen
In der klassischen und modernen Fitnesskultur wirken geschlechtsspezifische Ideale wie ein unsichtbares Korsett.
Männer sind häufig vom Adonis-Komplex betroffen: dem inneren Drang, muskulöser, definierter und „maskuliner“ zu werden, dabei unabhängig vom tatsächlichen Trainingszustand. Trotz objektiver Fitness empfinden sich viele Betroffene als zu dünn (umgangssprachlich im Fitnessjargon als Lauch), zu weich oder schlichtweg „nicht genug“.
Neurowissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass exzessives Bodybuilding mit Veränderungen in der emotionalen Verarbeitung und Impulskontrolle einhergehen kann. Maier et al. (2017) identifizierten in einer EEG-gestützten Untersuchung bei exzessiv trainierenden Männern neurophysiologische Muster, die jenen ähneln, die man auch bei Zwangsstörungen und Suchtverhalten beobachtet – etwa erhöhte Frontalaktivität im Ruhe-EKG oder abweichende P300-Amplituden [1]. Das unterstreicht, dass Muskelsucht kein Lifestyle-Phänomen ist, sondern ein ernstzunehmender neuropsychologischer Prozess.
Frauen stehen unter einem anderen, aber nicht minder problematischen Druck: dem „Toned Ideal“ – einem schlanken, aber zugleich kraftvollen, muskulösen sowie fitten Erscheinungsbild. Laut Neubauer et al. (2022) führt dieser doppelte Anspruch zu einer starken Selbstüberwachung, verbunden mit chronischer Unzufriedenheit. Selbst trainierte Frauen mit normalem oder unterdurchschnittlichem Körperfett empfinden sich durch die omnipräsente Vergleichskultur als „nicht fit oder schön genug“ – ein Zustand, der nachweislich mit erhöhter Depressivität und Essstörungsrisiken einhergeht [2].
Beide Ideale, ob, das überzeichnete Männliche wie das optimierte Weibliche, fördern ein Trainingsverhalten, das zunehmend von Angst, Kontrolle und Selbstzweifeln angetrieben wird. Essstörungen im Training sind kein Ausrutscher, sondern leider systemisch begünstigt.
Formen der Ess- und Körperbildstörungen bei Trainierenden
Die Wege in eine Ess- oder Körperbildstörung verlaufen häufig schleichend. Was zunächst als gesunde Lebensweise beginnt auch im Leistungssport mit bewussten Essen, regelmäßiges Training, Verzicht auf ungesunde Lebensmittel kann sich bei bestimmten Persönlichkeitsmustern und Umwelteinflüssen in pathologische Kontrollmechanismen verwandeln.
Orthorexie nervosa beschreibt beipsielsweise die zwanghafte Fixierung auf eine vermeintlich „reine“ oder „perfekte“ Ernährung. Betroffene vermeiden zunehmend ganze Lebensmittelgruppen, entwickeln rigide Regeln und erleben beim Verstoß starke Schuldgefühle oder Angst. Was anfänglich gesund erscheinen mag, führt im Alltag zu stärkeren sozialem Rückzug, Mangelversorgung und massivem psychischen Stress.
Eine weitere spezifische Störungsform ist die sogenannte Anorexia Athletica. Dabei kreist das gesamte Verhalten um das persönliche Ziel, den Körperfettanteil durch intensive Bewegung und gezielte Nahrungsrestriktion krampfhaft zu senken. Oft bemerken die Betroffenen es gar nicht, dass ihre Leistungsfähigkeit durch die ständige Unterversorgung an Energie nachlässt. Besonders heimtückisch: Von außen wirkt dieses Verhalten häufig diszipliniert oder sogar vorbildlich, was diese ungesunden Muster zusätzlich stabilisieren kann.
Auch das Auftreten von Binge-Eating-Episoden ist hochrelevant. In solchen Phasen essen betroffene Menschen in kurzer Zeit sehr große Mengen, meist begleitet von Scham, Schuldgefühlen und dem Bedürfnis, die Kalorien danach durch exzessives Training oder Fastenformen wieder „auszugleichen“. Wichtig ist: Dieses Verhalten tritt keineswegs nur bei Übergewicht auf, sondern auch bei Menschen, die äußerlich fit und gesund wirken.
Zentral in vielen Fällen ist die Entwicklung einer Körperschemastörung, also einer gestörten Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers. Betroffene empfinden sich trotz objektiver sportlicher Erscheinung als unförmig, zu dick, zu wenig definiert oder eben „nicht gut genug“. Diese kognitive Verzerrung wird durch ständige Spiegelkontrolle, „Body Checking“, Gewichtsfixierung und negativen Selbstsprech aufrechterhalten.
Die Metaanalyse von Badenes-Ribera et al. (2019) zeigt, dass insbesondere Personen mit Muskel-Dysmorphie, also einer übersteigerten Angst, nicht muskulös genug zu sein, hier eine signifikante Anfälligkeit für klassische Essstörungssymptome aufweisen. Der Zusammenhang ist statistisch robust und deshalb klinisch hochrelevant [3].
Besonders gefährdet sind dabei Menschen mit niedrigem Selbstwert, übersteigertem Perfektionismus, erhöhtem sozialem Vergleichsverhalten und einer hohen externen Leistungsorientierung. Wenn Training zur einzigen Quelle für Anerkennung und Selbstwirksamkeit wird, ist die Schwelle zur emotionalen Abhängigkeit oft schon überschritten. Neubauer (2022) betont, dass solche Persönlichkeitsmuster durch soziale Medien, Peer-Druck und eine leistungsorientierte Fitnesskultur zusätzlich befeuert werden [2].
Für Trainer/innen, Fachpersonal und Coaches, aber selbst für Athleten bedeutet das: Es braucht ein geschultes Auge für subtile Veränderungen im Verhalten, für unausgesprochene Überforderung und für psychische Belastungsanzeichen hinter perfekter Fassade.
Trainingssucht: Wenn Training zur Flucht wird
In Ergänzung zu klassischen Essstörungen zeigt sich zunehmend auch das Bild der Trainingssucht – ein Verhalten, das besonders im Ausdauer- und Fitnessbereich gelebt und häufig übersehen wird. Laut Ziemainz et al. (2013) sind Betroffene nicht mehr in der Lage, ihr Training bewusst zu steuern oder zu pausieren – selbst bei klaren Warnsignalen wie Erschöpfung, Schmerzen oder sozialen Konflikten [3].

Das Verhalten folgt den typischen Suchtmechanismen: Toleranzentwicklung, Kontrollverlust, Entzugserscheinungen und ein hoher Leidensdruck, wenn ein Training beispielsweise nicht möglich ist. Dabei dient das Training zunehmend nicht mehr der Förderung von Gesundheit oder Leistungsfähigkeit, sondern wird zu einer Art Kompensationsstrategie für inneren Stress, Unruhe oder Selbstwertdefizite.
Aus psychologischer Sicht betrachtet handelt es sich also, um eine funktionale Suchtform, bei der das Training als Vehikel genutzt wird, um negative Emotionen zu verdrängen oder die Eigenkontrolle über das Körperbild aufrechtzuerhalten. Dabei verlieren die Betroffenen die Fähigkeit zur Autoregulation und ihr Training wird aus falschen Gründen zum Pflichtzwang statt zur Wahl.
Ein zentrales Problem liegt in der gesellschaftlichen Fehlbewertung:
Während andere Süchte häufig mit Besorgnis betrachtet werden, gilt exzessives Training oft als besonders diszipliniert. In sozialen Netzwerken, Fitnesskulturen oder Trainerkreisen wird „No Days Off“-Mentalität gefeiert – selbst wenn dahinter bereits eine chronische Überforderung steht. Diese positive Rückkopplung aus dem Umfeld verhindert eine frühzeitige Wahrnehmung des Problems.
Meine eigenen Arbeiten in vergangenen Ausgaben der Athletik zeigen: Wenn Trainingssucht mit restriktiver Ernährung oder unzureichender Regeneration kombiniert wird, entsteht ein gefährliches biologisches Ungleichgewicht.
In meinem Artikel zur Low Energy Availability (LEA) [5] wird deutlich, dass viele Betroffene über Monate oder Jahre hinweg in einem Zustand chronischer Energieunterversorgung trainieren – mit massiven Folgen für Stoffwechsel, Hormonachse, Immunabwehr und mentale Gesundheit. Auch mein Beitrag zur Regeneration im Training [7] weist darauf hin, dass intensive Trainingsreize ohne adäquate Erholungsphasen nicht stärker machen, sondern krank. In der Sportsucht ist dieser Zusammenhang besonders kritisch, da Ruhephasen vermieden und kompensatorische Bewegungen (z. B. extra Cardioeinheiten) eingesetzt werden, um „Fehler“ in der Ernährung oder emotionale Spannungen zu regulieren.
Die langfristigen Konsequenzen reichen von Übertraining, Reduktion der Knochendichte, Schlafproblemen und Libidoverlust bis hin zur völligen sportlichen und sozialen Erschöpfung.
Die Herausforderung in der Praxis besteht darin, nicht nur auf Trainingsumfang oder Körperkomposition zu schauen, sondern auf die psychologische Flexibilität und die Qualität der Trainingsmotivation. Gerade im Vereinsumfeld wird extremes Training seltener hinterfragt besonders, wenn Erfolge sichtbar sind oder die Person als diszipliniert gilt.
Low Energy Availability (LEA) und RED-S: Unsichtbare Gefahren
Eines der größten – oft unterschätzten – Risiken ist ein chronisches Energiedefizit. Low Energy Availability (LEA) beschreibt den Zustand, in dem nach Abzug des Trainingsenergieverbrauchs zu wenig Energie für lebenswichtige Funktionen übrig bleibt [5]. Frühe Symptome sind Erschöpfung, Infekte, Stimmungsschwankungen und Leistungsstagnation.
Wird LEA nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, kann sich daraus RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport) entwickeln: Ein Syndrom, das das gesamte physiologische System betrifft. Es schädigt das Hormonsystem, die Knochengesundheit, die Fruchtbarkeit, das Herz-Kreislauf-System und die mentale Verfassung.
Besonders dramatisch: In der Fitnesskultur werden Anzeichen von RED-S u.a. eiserne Disziplin, Trainingsbesessenheit oder sichtbare Gewichtsveränderungen häufig als vorbildlich wahrgenommen. Dadurch entzieht sich das Problem häufig einfach der kritischen Betrachtung.
Besondere Risikogruppe: Kinder und Jugendliche
Schon Kinder und Jugendliche geraten durch soziale Medien und unrealistische Vorbilder früh unter Druck. Diäten, Körperunzufriedenheit und der Zwang zu viel Bewegung beginnen häufig schon im Schulalter gleichermaßen bei Mädchen wie Jungen. Häufig steckt der Wunsch nach Anerkennung dahinter, begleitet von Perfektionismus und geringem Selbstwert. Weil solche Entwicklungen oft lange unentdeckt bleiben, braucht es frühzeitig Aufklärung, ehrliche Gespräche und realistische Vorbilder in Schule, Sport, Verein und Familie [6].
Früherkennung und Prävention: Wie wir Körper und Geist schützen
Wer genau hinsieht, erkennt Warnzeichen frühzeitig: rigides Essverhalten, zwanghaftes Training, Isolation und ständige Selbstabwertung. Auch der Rückzug von gemeinsamen Mahlzeiten oder eine auffällige Beschäftigung mit Kalorien, Diäten oder „Clean Eating“ können ernste Hinweise sein.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Lisa, 26, verpasst kein Training – auch nicht mit Fieber. Sie wiegt ihre Haferflocken auf’s Gramm genau und hat ihre Periode seit sieben Monaten nicht mehr. Ihr Umfeld lobt sie für ihre Disziplin.
Trainer/innen und Trainingspartner/innen tragen Verantwortung:
Sie sollten Gesundheit, Funktion und Lebensfreude stärken, nicht ästhetische Ideale oder Extremziele. Eine nachhaltige Trainingskultur beginnt mit Gesprächsbereitschaft, realistischen Zielvereinbarungen und einer ausgewogenen Kommunikation über Ernährung und Körperbild.
Ernährung muss als Teil eines flexiblen, bedarfsgerechten Gesamtkonzepts verstanden werden, nicht als moralischer Maßstab [6]. Das bedeutet: Kein Lebensmittel ist per se „gut“ oder „schlecht“. Wichtig ist die langfristige Balance.
Aufklärung über realistische Körperbilder, das Aufbrechen von Ernährungsmythen und eine Trainingsplanung, die Regeneration, Tagesform und individuelle Lebensumstände ernst nimmt, sind zentrale Elemente der Prävention [5,6,7].
Fazit: Fitness ist mehr als ein Körperbild
Fitness darf kein Wettbewerb der Optik werden. Wer Training und Ernährung als Werkzeuge zur Stärkung von Gesundheit, Funktion und Identität versteht, bewahrt die Balance. Ess- und Körperbildstörungen zeigen, wie wichtig Bewusstsein, Bildung und kritisches Denken in einer ästhetisch orientierten Trainingswelt sind. Die differenzierte Sichtweise ist hierbei entscheidend.
Die Aufgabe für die Zukunft lautet: Eine neue Fitnesskultur zu etablieren und zu schaffen, in der Stärke und Erfolg im Training nicht nur im Sixpack liegen, sondern im selbstbestimmten, reflektierten Umgang mit dem eigenen Körper. Das wird das Gesamtbild von Fitness auch weiter in das positive verschieben und diesem noch mehr Anerkennung geben. Ein gesunder Körper beginnt mit einem gesunden Geist und mit dem Mut, sich nicht ständig vergleichen und messen zu müssen.
Über den Autor
Daniel Schoon ist seit 15 Jahren als Fitness- und Gesundheitsexperte tätig. Als Fitnessstudioleiter, Autor, Speaker und Podcasthost vereint seine Arbeit evidenzbasierte Ansätze zur Prävention und Gesundheitsförderung im deutschsprachigen Raum.
Literaturverzeichnis
- Maier, M. J., Haeussinger, F. B., Hautzinger, M., Fallgatter, A. J., & Ehlis, A.-C. (2017). Excessive bodybuilding as pathology? A first neurophysiological classification. Journal of Affective Disorders, 205(8), 626–636. https://doi.org/10.1080/15622975.2017.1395070
- Neubauer, A.-L. (2022). Soziale Einflüsse und internalisierte Körperideale bei Frauen im Fitnesssport (Masterarbeit). MSH Medical School Hamburg. https://opus.bsz-bw.de/msh/frontdoor/index/index/docId/19
- Badenes-Ribera, L., Rubio-Aparicio, M., Sánchez-Meca, J., Fabris, M. A., & Longobardi, C. (2019). The association between muscle dysmorphia and eating disorder symptomatology: A systematic review and meta-analysis. Journal of Behavioral Addictions, 8(3), 351–371. https://doi.org/10.1556/2006.8.2019.44
- Ziemainz, H., Stoll, O., Drescher, A., Erath, R., Schipfer, M., & Zeuler, B. (2013). Die Gefährdung zur Sportsucht in Ausdauersportarten. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 64(2), 57–64. https://doi.org/10.5960/dzsm.2012.057
- Schoon, D. (2025). Low Energy Availability – Leistung in Gefahr.DBA Online. https://dba-online.de/low-energy-availability/ (Zugriff: April 2025)
- Schoon, D. (2025). Mangelernährung durch Foodtrends und Diäten: Die Risiken einseitiger Ernährungstrends und der Einfluss auf ein gestörtes Essverhalten. Ernährung & Medizin, 40(01), 7–13. https://doi.org/10.1055/a-2522-5736
- Schoon, D. (2025). Regeneration im Training – Bedeutung für Gesundheit und Fortschritt. DBA Online. https://dba-online.de/regeneration-im-training/ (Zugriff: April 2025)
Weitere Referenzen
Fatt, S. J., George, E., Hay, P., Jeacocke, N., Gotkiewicz, E., & Mitchison, D. (2024). An umbrella review of body image concerns, disordered eating, and eating disorders in elite athletes. Journal of Clinical Medicine, 13(14), 4171. https://doi.org/10.3390/jcm13144171
National Eating Disorders Association. (2024). Eating Disorders and Athletes. NEDA. https://www.nationaleatingdisorders.org/eating-disorders-and-athletes-2/
McLean Hospital. (2024). Athlete Mental Health: What You Need To Know. https://www.mcleanhospital.org/essential/athlete-mh