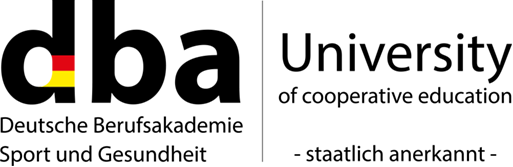Fett macht (nicht) fett?
Die richtige Auswahl, Menge und Kombination, um Leistung zu erbringen, Energie zu haben und trotzdem schlank zu bleiben.
Schlank bzw. in Form sein und bleiben: Das ist glücklicherweise nicht die einzige Motivation, um Sport zu treiben. Dennoch ist es für viele zumindest ein Grund, sich regelmäßig sportlich zu betätigen. Meist spielen dabei zwei Aspekte eine Rolle. Zum einen das Gewicht, also die reinen Zahlen auf der Waage, zum anderen die Optik, sprich wie die vorhandene Körpermasse zusammengesetzt und verteilt ist. Je nach Motivation und Zielsetzung steht dabei mal der eine, mal der andere Aspekt stärker im Fokus. Doch egal, ob es darum geht, den Auswirkungen eines überwiegenden sitzenden Jobs entgegenzuwirken, angesammelte Urlaubs- oder Feiertagskilos loszuwerden, die Gewichtsklasse für einen bestimmten Wettkampf zu erreichen oder den Körperfettanteil für den Auftritt auf der Bühne zu reduzieren: Das Thema “Fett” spielt so gut wie immer eine Rolle. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang regelmäßig auftritt: Macht Fett aus der Nahrung wirklich “fett”? Wenn ja, sollte ich wann immer möglich darauf verzichten? Und muss ich zwingend den Fettanteil in meiner Nahrung herunterfahren, um meinen Körperfettanteil zu reduzieren? Eng damit gekoppelt sind natürlich Überlegungen, welche Auswirkungen dies jeweils auf die körperliche Leistungsfähigkeit hat, gerade bei aktiven Sportlern. Insgesamt zeigt sich schnell, dass es ganz ohne Fette nicht geht. Denn sowohl für Leistung als auch für langfristige Gesundheit braucht unser Körper zwingend ein gewisses Maß an Fetten. Doch wie viel ist dabei zu viel? Oder mit anderen Worten: Wie decke ich meinen Bedarf auf gesunde Weise und ohne erhebliche Gewichtszunahme?
Dieser Frage widmet sich eine ganze Reihe mehr oder weniger fundierter Publikationen, Kurse, Apps und Coachingprogramme. Angesichts des aktuellen Schönheitsideals mit der Bevorzugung schlanker, durchtrainierter Körper überrascht dieser Trend nicht. Meist steht deshalb ganz an oberster Stelle die Frage nach der perfekten Abnehmstrategie und dem schnellsten Weg, (Bauch-)Fett loszuwerden. In gewisser Hinsicht haben diese Überlegungen durchaus ihre Berechtigung. Einer aktuellen Studie des RKI zufolge sind derzeit zwei Drittel der Männer (67%) und über die Hälfte der Frauen (52%) übergewichtig.[1] Der Markt der potenziellen Interessenten (und Nutzer) ist somit zweifelsohne vorhanden. Allerdings stellt sich bei den Abnehm- bzw. Fettabbauwilligen schnell Frust ein. So wird in der Regel schon nach kurzer Zeit klar, dass zumindest im Hobbybereich Bewegung allein nicht ausreicht. Der Slogan “abs are made in the kitchen” – “ein Sixpack entsteht in der Küche” kommt nicht von ungefähr.
Unabhängig davon, ob Gewicht reduziert, der Körperfettanteil gesenkt und Muskelmasse erhalten oder aufgebaut werden soll: Ohne die entsprechende Ernährung bleiben greifbare und vor allem nachhaltige Resultate aus. Das gilt nicht zuletzt für den ambitionierten Wettkampf- und Leistungsbereich. Hier müssen für Spitzenleistungen mittlerweile alle Stellschrauben genutzt werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Hinzu kommt, dass inzwischen ein wachsendes Bewusstsein für die gesundheitlichen Auswirkungen unserer Ernährung eingetreten ist. Viele suchen deshalb nach Mitteln und Wegen, um auf sinnvolle und gesunde Weise ihr Gewicht und ihre Körperzusammensetzung zu beeinflussen.
Gerade das Internet bietet eine wahre Flut an Informationen zum Thema Ernährung, Training und Fett. Allerdings könnte hier die Bandbreite fast nicht größer sein: Von Low-Fat über Atkins bis hin zu diversen Tropfen, Pulvern und anderen Wundermitteln ist fast alles dabei. Nicht selten führt dies zu Verwirrung und Unsicherheit bei den Ratsuchenden. Was lässt sich also wissenschaftlich gesichert zum Thema „Fette“ sagen? Wofür braucht unser Körper sie, was sollten wir bei Auswahl, Zusammensetzung und Dosierung beachten und wo macht eine Reduzierung des Fettgehalts in unserer Nahrung wirklich Sinn?
Fette – ein Makronährstoff mit wichtigen Aufgaben
Wie die Kohlenhydrate und Proteine zählen die Fette zu den sogenannten Makronährstoffen. Diese Makronährstoffe, umgangssprachlich „Makros“, bezeichnen Nahrungsbestandteile, die Energie liefern oder liefern können. Gerade Fette spielen als Energielieferanten eine bedeutsame Rolle. Sie verfügen unter den Makronährstoffen über den höchsten Brennwert. Pro Gramm liefern sie ca. 9 kcal (37 kJ) an Energie – das ist etwa doppelt so viel wie bei Proteinen oder Kohlenhydraten.
Neben ihrer Funktion als Energielieferanten (Energiequelle durch die Bildung von ATP) erfüllen Fette in unserem Körper eine Reihe lebenswichtiger Aufgaben. Dazu zählen:
- Bildung von Depotfett als Energiespeicher, Wärmeisolator und Druckpolster
- Trägersubstanz fettlöslicher Vitamine und damit Aufnahme von Vitaminen
- Ausgangssubstanz zur Bildung von Gallensäuren (Fettverdauung), Vitamin D und Steroidhormonen (Sexualhormone sowie Gluco- und Mineralocorticoide)
- Synthese von Signalmolekülen (Eicosanoide), relevant für Entzündungsprozesse und Fließeigenschaften des Blutes
- Bestandteile von Zellmembranen
Aufgrund dieser essentiellen Aufgaben sollten wir unbedingt darauf achten, eine gewisse Menge an Fetten über die Nahrung aufzunehmen. Denn was bei Empfehlungen für eine extreme Reduktion der Fettzufuhr häufig übersehen wird: Fette haben überaus wichtige funktionelle Aufgaben für unseren Körper. Um diese aufrecht zu erhalten, müssen wir zwingend vor allem die essentiellen Fette, die der Körper nicht selbst herstellen kann, über die Nahrung zuführen. Die Fette kommen vor allem dann ins Spiel, wenn es um das hormonelle Gleichgewicht, Entzündungsprozesse und die Versorgung unseres Körpers mit den fettlöslichen Vitaminen (Vit A, E, D, K) geht. Aus genau diesem Grund empfiehlt es sich nicht, den Fettgehalt der Nahrung dauerhaft massiv herunterzufahren, selbst wenn Fette gute Energielieferanten sind und damit im Vergleich zu den anderen beiden Makros mit mehr Kalorien zu Buche schlagen.
Wie viel Fett genau? Die richtige Dosis finden
Doch wie viel Fett ist nun eigentlich zu viel, gerade richtig oder zu wenig? Betrachtet man die aktuellen Empfehlungen bezüglich der empfohlenen Fettzufuhr im ambitionierten Breiten- und Leistungssport ergibt sich ein Richtwert von 30 En% für gesunde Jugendliche und Erwachsene. Personen mit erhöhtem Energiebedarf (physical activity level [PAL] > 1,7) können höhere Prozentsätze benötigen.
Internationale Fachgesellschaften sprechen sich als Obergrenze vor allem in Bezug auf den Ausdauersport für eine Beschränkung der Fettzufuhr auf 30 En% aus. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in Ausdauerdisziplinen die Energielieferung durch Kohlenhydrate vorrangig ist.
Ebenso existiert eine Untergrenze, die nicht unterschritten werden sollte. Sie liegt bei 15 – 20 %. So wird sichergestellt, dass
- ausreichend essenzielle Fettsäuren und fettlösliche Vitamine zugeführt bzw. absorbiert werden,
- zwischen den Mahlzeiten ein Gefühl der Sättigung besteht,
- die intramuskulären Triglyceride nach langdauernden Belastungen wieder aufgefüllt werden,
- eine positive Beeinflussung des Immunsystems stattfindet und der Hormonhaushalt ausgeglichen ist.
“Gute” vs. “schlechte” Fette – was ist die beste Wahl?
Die Einteilung in “gute” und “schlechte” Fette hat inzwischen vermutlich jeder schon einmal zumindest gehört. Doch was genau macht ein “gutes” Fett aus? Und wie erkenne ich es?
Zu den Fetten, die man in eher geringer Menge konsumieren sollte, zählen vor allem die gesättigten Fette und die Transfette. Eine gesundheitsfördernde Wirkung wird dagegen den einfach ungesättigten sowie den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zugeschrieben. Allerdings gilt auch hier: Die Dosis macht’s! Das bedeutet, selbst die “guten” Fette sollten wir nicht in einem absoluten Übermaß konsumieren.
| (tendenziell) “schlechte” Fette | (tendenziell) “gute” Fette |
| – gesättigte Fette (z. B. Kokosfett, Butter, Sahne, Palmöl, Schmalz, Speck). Ihr hoher Anteil an gesättigten Fettsäuren ist assoziiert mit Gefäßerkrankungen wie Atherosklerose und Erkrankungen des Herzkreislaufsystems. Daher sollten sie nicht übermäßig konsumiert und wenn möglich durch einfach ungesättigte Fettsäuren ersetzt werden. | – einfach ungesättigte Fettsäuren (z. B. Olivenöl, Haselnüsse, Erdnussöl, Avocado, Rapsöl, Cashews). Ihnen wird eine gefäßprotektive Wirkung sowie eine positive Beeinflussung der Fließeigenschaften des Blutes zugeschrieben |
| – Transfette, v.a. in Fast Food, frittierte Produkten und insgesamt stark verarbeiteten Lebensmitteln (z. B. Blätterteiggebäck, Zwieback, Cracker, Kartoffelchips, Instantsuppen, Margarine aus einer Öl-Sorte). Sie erhöhen das LDL-Cholesterin und senken gleichzeitig das HDL-Cholesterin. Damit steigt das Risiko für Atherosklerose. | – mehrfach ungesättigte Fette (z. B. Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Hanföl, Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl). Sie wirken gefäßprotektiv, antientzündlich immunprotektiv und beeinflussen ebenfalls die Fließeigenschaften des Blutes positiv. |
Auf die Qualität der Fette kommt es an!
Wie bereits dargestellt übernehmen die Fette zentrale hormonelle und Signalfunktionen in unserem Körper. Deshalb ist es so entscheidend, sie a) ausreichend zuzuführen und b) dabei jeweils auf die entsprechende Qualität zu achten. Folgende Richtlinien helfen, die Anteile der einzelnen Fettsäurefraktionen ideal zusammenzustellen:
- 10 En% gesättigte Fettsäuren (max. ein Drittel der als Fett zugeführten Energie)
- 7 – 10 En% mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Summe aus omega-3- und omega-6-Fettsäuren)
- einfach ungesättigte Fettsäuren > 10 %
- Anteil der Transfettsäuren < 1 En%[2]
Für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten, hier noch eine detailliertere Aufschlüsselung der mehrfach ungesättigten essentiellen Fettsäuren: Die empfohlene Zufuhr für die essenziellen Fettsäuren, die im menschlichen Körper nicht gebildet werden können, beträgt für Jugendliche und Erwachsene 2,5 En% für Linolsäure (omega-6, ~6,5g/d) und 0,5 En% für α-Linolensäure (omega-3, 1,3g/d). Daraus ergibt sich ein Verhältnis von 5:1. 5:1 sollte jedoch als Mindestangabe betrachtet werden. Als noch günstiger erweist sich ein Verhältnis von 4:1 von omega-6 zu omega-3 Fettsäuren. Diese Werte werden durch die westliche Ernährung in der Regel keineswegs erreicht. Vielmehr liegt das Verhältnis derzeit eher bei 10:1! Somit besteht noch viel Aufholbedarf bei der Optimierung der Fettqualität, v.a. auch bei Sportlern.
Möchte man seine Ernährung diesbezüglich optimieren, lässt sich der Bedarf unkompliziert mit Hilfe bestimmter Nahrungsmittel decken. Perfekte Quellen für ungesättigte Fette sind beispielsweise:
Nahrungsquellen für ungesättigte Fette → pro 10 g:
Leinöl: 4,9
Walnussöl: 1,3 / eine Handvoll Walnüsse 0,9
Rapsöl: 0,9
Sojaöl: 0,8
Für unsere Gesundheit darüber hinaus zentral ist der EPA- und DHA- (Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure)-Anteil. Diese omega-3 Fettsäuren spielen eine bedeutende Rolle im Entzündungsgeschehen und für unser Immun- und Herzkreislaufsystem. Es sollte daher idealerweise eine Zufuhr in folgendem Bereich angestrebt werden: mind. 250 mg/d, max 3 g/d. Als Nahrungsquellen eignen sich (Angaben jeweils pro 100 g): Makrele: 2,3, Lachs: 1,9, Hering: 1,5 g. Für Vegetarier und Veganer empfiehlt sich oft eine Substitution mit Supplementen.
Gewichtsabnahme, Fettzufuhr und sportliche Leistung – was ist zu beachten?
Wie schon zu Beginn dieses Artikels erwähnt, spielt die Frage nach dem momentanen Gewicht bei vielen aktiven Sportlerinnen und Sportlern eine Rolle. Hier steht in der Regel nicht der Abbau von Übergewicht, sondern die Einhaltung bestimmter Gewichtsklassen im Vordergrund. Gerade bei Sportarten, bei denen die Bewertung nach Gewichtsklassen erfolgt, ist die Wettkampfvorbereitung in der finalen Phase nicht selten vom Bemühen geprägt, punktgenau ein bestimmtes Zielgewicht zu erreichen, dabei jedoch keinesfalls physische Leistungsfähigkeit einzubüßen. Ist für das Erreichen des angepeilten Gewichts noch eine Abnahme in größerem Umfang notwendig, stellt sich die drängende Frage nach der geeigneten Diät. Dabei steht nachvollziehbarerweise im Vordergrund, wie die Leistungsfähigkeit erhalten und einem Verlust an Muskelmasse vorgebeugt werden kann. Wie lässt sich hier am besten vorgehen?
Letztendlich ist der Schlüssel zu einer effektiven Gewichtsabnahme die sinnvolle Verteilung aller drei Makronährstoffe. Anders als oftmals in den Populärmedien postuliert, geht es dabei jedoch keineswegs nur um die Reduktion von Fett! Zudem ist die Gewichtsabnahme gerade bei Sportlern an bestimmte Bedingungen geknüpft. Grundlegendes Ziel ist es, Körperfett zu reduzieren, die “lean body mass” (LBM) dabei aber zu erhalten. Dafür reicht eine reine Kalorienreduktion nicht aus. Denn diese geht oft mit einem Verlust von LBM einher.
Die Lean Body Mass ist die Magermasse des Körpers, d.h. das Körpergewicht minus Speicherfett. Die fettfreie Körpermasse (FFM) korreliert hoch mit der gegenüber der Fettmasse (FM) wasserreicheren „Muskelmasse“.[3]
Deshalb ist insbesondere in der Wettkampfvorbereitung bei einer Diät vor allem auf die Zusammensetzung der Makronährstoffe zu achten. Das gilt unabhängig davon, wie stark die Gesamtzahl der Kalorien verringert wird.
Proteinbetonte kalorienreduzierte Diät – sinnvoller und schonender Gewichtsabbau
Welche Ernährungsform bietet sich an, wenn einerseits Gewicht reduziert, andererseits die lean body mass aufrechterhalten werden soll? Neueste Studien[4] zeigen, dass bei hypokalorischen Diäten eine proteinbetonte Herangehensweise eine höchst wirksame Methode darstellt. Diese Form erlaubt es, über einen definierten (begrenzten) Zeitraum Fettmasse abzubauen und dabei die lean body mass zu erhalten. Genau dieser Zeitraum, über den die Gewichtsabnahme erfolgt, spielt eine entscheidende Rolle. So ist es günstiger, die Gewichtsabnahme über eine längere Phase hinweg zu planen
(~ – 500 kcal/d, entspricht ca. 0,5 kg KG-Verlust pro Woche). Auf diese Weise lässt sich ein größerer Verlust von LBM vermeiden. Ebenso werden die hormonellen Stoffwechseladaptationen des Körpers gegen den Gewichtsverlust verlangsamt oder vermieden.
Was genau steht hinter diesen hormonellen Prozessen und Anpassungen? Hypokalorische Diäten induzieren eine Reihe von endogenen, Stoffwechsel- und Hormonanpassungen. Diese dienen dazu, einen weiteren Gewichtsverlust zu verhindern und Energie zu sparen. Es wird angenommen, dass das Ausmaß dieser Anpassungen proportional zur Größe des Energiedefizits ist. Mit anderen Worten, je höher das Energiedefizit, desto stärker die Anpassungsreaktion. Aus exakt diesem Grund empfiehlt man, das kleinstmögliche Defizit zu wählen, das zu einem nennenswerten Gewichtsverlust führt. Dadurch verringert sich zwar die Geschwindigkeit der Gewichtsabnahme, ungünstige Anpassungen, die eine erfolgreiche Reduzierung der Fettmasse erschweren, werden jedoch abgeschwächt. Eine weitere hilfreiche Strategie besteht darin, die Gewichtsreduktion als schrittweisen Prozess zu betrachten. Wenn der Gewichtsverlust zu stagnieren beginnt, gilt es, die Energiezufuhr oder den Energieverbrauch anzupassen, d.h. wieder zu erhöhen. So wird das Energiedefizit erneut „geöffnet“.[5] Sehr große Kaloriendefizite führen dagegen wahrscheinlich zu größeren Verlusten an Muskelmasse. Somit beeinträchtigen sie die sportliche Leistung und Erholung, die für Sportler von entscheidender Bedeutung sind.
Wie sieht eine solche hypokalorische Diät in der Praxis aus? Die täglichen Mahlzeiten sollten 1,5-2 g/kg Eiweiß enthalten.[6] Manche Studien[7] postulieren höhere Eiweißmengen von 1,6 – 2,4 g/kg, um die lean body mass zu erhalten. Ebenso sollten mindestens 4-6 g/kg Kohlenhydrate und ≥15-20 % der Gesamtenergiezufuhr aus Fett enthalten sein. Die genauen Werte für Sportlerinnen und Sportler sind dabei allerdings sportartspezifisch. So benötigen Ausdauersportler grundsätzlich mehr Kohlenhydrate als beispielsweise Kraftsportler. Dementsprechend muss der Bedarf innerhalb der Grenzbereiche individuell angepasst werden.
Bezüglich der Körperzusammensetzung besteht die Empfehlung, dass der Anteil des Körperfetts nach dem Gewichtsverlust bei Männern nicht 5 % und Frauen nicht 12 % unterschreitet. Andernfalls droht die Gefahr von hormonellen Dysbalancen, bei Frauen etwa das Ausbleiben der Menstruation. Zudem können negative Auswirkungen auf das Immun- und kardiovaskuläre System eintreten sowie unerwünschte neuronale Effekte. Genau dieser Aspekt wird häufig vernachlässigt, wenn Fett als Dickmacher verteufelt wird! Denn wie schon mehrfach hervorgehoben, verfügen Fette zwar über eine vergleichsweise hohe Energiedichte, erfüllen aber zentrale funktionale physiologische Aufgaben, hier allen voran die essentiellen Fette. Deshalb sind sie wertvoll und notwendig für einen gesunden Organismus.
Als ergänzende Maßnahme hat sich in Studien[8] die Durchführung eines strukturierten resistance training bewährt, insbesondere in Verbindung mit einer ausreichenden Proteinzufuhr. Durch diese Kombination ließ sich dem Verlust von Muskelmasse offensichtlich ebenfalls entgegenwirken. Hier zeigt sich, dass es immer sinnvoll ist, auf mehrere Komponenten zu setzen. Ausschließlich Bewegung und Training werden ebenso wenig zum Ziel führen, wie eine ausschließliche Konzentration auf die Ernährung!
Ein weiterer Vorteil von eiweißreichen Diäten (≥25% PRO) besteht darin, dass sie mit einer erhöhten Sättigung und Thermogenese in Verbindung gebracht werden. Das macht sie zu einer geeigneten Option für Athleten, die ein Kaloriendefizit fahren wollen.
Aus wissenschaftlicher Sicht erweist sich – zumindest wenn man den aktuellen Stand der Forschungslage betrachtet – folglich eine hypokalorische Diät mit ausreichender Proteinzufuhr als höchst sinnvolle und empfehlenswerte Variante. Dennoch soll abschließend noch kurz auf eine weitere Diätform eingegangen werden, die gerade in Sportlerkreisen weit verbreitet ist.
Ketogene Diät – über extremes Low Carb zur Traumfigur?
Bei der ketogenen Diät (KD) handelt es sich um eine “Extrem”form der Low Carb Diät. Hierbei begrenzt man die Aufnahme von Kohlenhydraten auf < 50 g/d. Das entspricht etwa 10 % der Energieaufnahme. Gleichzeitig wird ein moderater Eiweißanteil beibehalten (1,2-1,5 g/kg/d). Die restliche Energiezufuhr stammt überwiegend aus Fett (~60-80 % oder mehr, je nach Grad der Verringerung von Eiweiß und Kohlenhydraten). Das hat folgenden Effekt: Sind wenige Kohlenhydrate vorhanden, werden aus Acetyl-CoA aus der Fettoxidation die sogenannten Ketonkörper gebildet. Sie dienen nun als Energiequelle.
Angestrebt wird letztendlich, durch eine Verringerung der Kohlenhydrate eine Anpassung hin zu einer verbesserten Fettverwertung zu erzielen. Zudem sollen die Glykogenspeicher in Muskel und Leber geschont und damit Leistungsfähigkeit und Trainingsdauer verlängert werden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass eine ketogene Ernährung die Laktatakkumulation nach dem Training verringert und so zu einer besseren Erholung beiträgt[9]. Die Theorie bzw. Modellvorstellung dahinter ist, dass durch Ketose eine geringere Abhängigkeit von Kohlenhydraten entsteht, die wiederum förderlich für sportliche Leistungen ist. In der Realität zeigt sich jedoch, dass die KD gerade bei Ausdauersportlern häufig eher ergolytisch wirkt oder schlichtweg keinen Vorteil bringt. Dazu weiter unten noch mehr!
Betrachten wir hier zunächst, wie geeignet eine ketogene Diät mit sehr niedrigem Kohlenhydratgehalt für den Gewichtsverlust ist. Offensichtlich handelt es sich grundsätzlich um eine durchaus effektive Maßnahme. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Belege für positive Auswirkungen auf die kurzfristige Gewichtsabnahme ergeben. Diese Effekte sind natürlich höchst attraktiv für Sportler, die schnell Fettmasse verlieren wollen oder müssen. Erklärt wird dieser Verlust an Körperfett meist mit der veränderten Stoffwechsellage und der daraus resultierenden positiven Beeinflussung der Insulinempfindlichkeit, der Blutzuckerkontrolle sowie der Serumlipidwerte. Allerdings muss gleichzeitig gesagt werden: Mit wenigen Ausnahmen haben bisherige kontrollierte Interventionen, bei denen die Protein- und Energiezufuhr zwischen KD- und Nicht-KD-Bedingungen abgeglichen wurde, keinen Vorteil für den Fettabbau durch KD gezeigt.
Wie lassen sich diese Erkenntnisse deuten? Betrachtet man die Forschungsergebnisse genauer, liegt es nahe, dass die „besonderen Wirkungen“ von Low Carb Diäten und KD nicht auf ihren angeblichen Stoffwechselvorteil zurückzuführen sind. Stattdessen liegt die Wirkung unter Umständen am erhöhten Proteingehalt bei gleichzeitigem Kaloriendefizit. Proteine verfügen grundsätzlich über einen höheren thermogenen und sättigenden Effekt. Dieser wirkt sich günstig auf den Fettabbau aus. Man könnte folglich argumentieren, dass die KD letztlich eine Sonderform der proteinbetonten Diät darstellt. Mit anderen Worten: Wir sind zurück bei den Proteinen und damit unserem initialen Ausgangspunkt für effektiven Fettabbau!
Falls die Entscheidung dennoch für eine ketogene Ernährung fällt: Für wen ist diese überhaupt geeignet? Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit für Ausdauer- und Kraftsportler deuten Studien darauf hin, dass eine ketogene Diät bei Ausdauersportlern zu keiner Leistungssteigerung führt. Im Gegenteil, einzelne Untersuchungen weisen sogar einen ergolytischen Effekt als Folge einer fettreichen, kohlenhydratarmen Ernährung nach (z.B. früher eintretende Erschöpfung, höherer Sauerstoffbedarf zum Erreichen eines bestimmten Tempos, verstärkte Belastung durch Verdauungsbeschwerden, Verringerung des allgemeinen Wohlbefindens). Ebenso könnte die veränderte Stoffwechsellage dazu führen, dass zwar die Fettnutzung verbessert, dafür jedoch die Kohlenhydratverwertung heruntergefahren wird.
Anders sieht es hingegen bei Kraft- und Ästhetiksportlern aus. So zeigen erste Studien, dass bei effektivem Gewichts- und Fettmasseverlust kein Verlust an körpergewichtsbezogener Kraftleistung auftreten muss. Damit eignet sich nach bisherigem Stand die KD eher für Kraft- und Ästhetiksportler als für Ausdauersportler, wenn es darum geht, die Körperkomposition zu verändern und bestimmte Gewichtsklassen zu erreichen. Dennoch ist eine gewisse Vorsicht geboten. In jedem Fall sollte eine KD zeitlich begrenzt bleiben, da Lebensmittel mit hoher Mikronährstoffdichte und Ballaststoffen, wie z. B. Obst und Getreideprodukte, nur sehr eingeschränkt verzehrt werden. Bei langfristiger Anwendung dieser doch einseitigen Ernährung können so Mängel an Mikronährstoffen auftreten, die letztendlich negative Effekte auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben.
Mit Qualität und geschickter Zusammensetzung zum Erfolg – die richtige Dosis an Fetten für Leistungsfähigkeit und Ästhetik
Zusammengefasst lässt sich somit sagen: Fette per se sind alles andere als schlecht für unseren Körper und führen nicht zwangsläufig zu einer Gewichtszunahme. Ganz im Gegenteil, unser Körper braucht einen gewissen Fettanteil, um essentielle physiologische Funktionen aufrechtzuerhalten. “Schädlich” werden Fette immer dann, wenn sie in einem Übermaß konsumiert werden und/oder bei der Ernährung vor allem auf ein Übermaß einer bestimmten Fettart, etwa ein Zuviel an gesättigten Fetten, gesetzt wird.
Strebt man dagegen eine ausgewogene Ernährung an, die den Körper schlank und leistungsfähig erhält, lohnt es sich, auf hochqualitative Fette in der entsprechenden Zusammensetzung zu achten. Sie liefern uns die notwendigen Komponenten für die Funktionsfähigkeit unseres Körpers. Wird für eine Gewichtsreduktion bei gleichzeitigem Erhalt der Muskelmasse ein Kaloriendefizit angestrebt, sind nach aktuellem Stand der Forschung vor allem proteinbetonte Diätformen am vielversprechendsten. Sie verhelfen uns zu einem effektiven Gewichtsverlust und erhalten gleichzeitig die gewünschte lean body mass. Auf diese Weise lässt sich die angestrebte Wirkung auf gesunde und nachhaltige Weise herbeiführen!
Noch weitere Fragen oder Interesse an einer Zusammenarbeit/Beratung? Die beiden Autorinnen stehen sehr gerne zur Verfügung und freuen sich über alle Rückmeldungen!
Kontakt: Dr. Sabine Nunius | sabine.nunius@sanu-training.com
[1] https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Themen/Uebergewicht_Adipositas/Uebergewicht_Adipositas_node.html, abgeruf. 15.08.2022
[2] Schek A, Braun H, Carlsohn A, Großhauser M, König D, Lampen A, Mosler S, Nieß A, Oberritter H, Schäbethal K, Stehle P, Virmani K, Ziegenhagen R, Heseker H (2019) Fats in sports nutrition. Position of the working group sports nutrition of the German Nutrition Society (DGE). Ernahrungs Umschau 66(9): 181–188.
[3] https://flexikon.doccheck.com/de/Lean_body_mass
[4] Sports Med. 2014 Nov;44 Suppl 2(Suppl 2):S149-53.
Jäger, R., Kerksick, C.M., Campbell, B.I. et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr 14, 20 (2017). https://doi.org/10.1186/s12970-017-0177-8
[5] Eric T Trexler, Abbie E Smith-Ryan & Layne E Norton (2014) Metabolic adaptation to weight loss: implications for the athlete, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 11:1, DOI: 10.1186/1550-2783-11-7
[6] Jorunn Sundgot-Borgen & Ina Garthe (2011) Elite athletes in aesthetic and Olympic weight-class sports and the challenge of body weight and body compositions, Journal of Sports Sciences, 29:sup1, S101-S114, DOI: 10.1080/02640414.2011.565783
[7] Witard, O. C., Garthe, I., & Phillips, S. M. (2019). Dietary Protein for Training Adaptation and Body Composition Manipulation in Track and Field Athletes, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 29(2), 165-174. Retrieved Aug 17, 2022, from https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijsnem/29/2/article-p165.xml
[8] Hector, A. J., & Phillips, S. M. (2018). Protein Recommendations for Weight Loss in Elite Athletes: A Focus on Body Composition and Performance, International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 28(2), 170-177. Retrieved Aug 17, 2022, from https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijsnem/28/2/article-p170.xml
[9] Caitlin P. Bailey & Erin Hennessy (2020) A review of the ketogenic diet for endurance athletes: performance enhancer or placebo effect?, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 17:1, DOI: 10.1186/s12970-020-00362-9