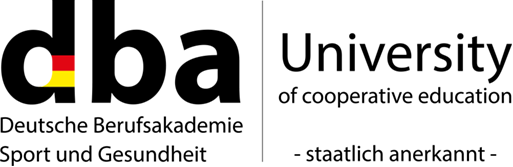Wie trainieren Ausdauersportler sinnvoll im Fitnessstudio?
Prof. Dr. Kuno Hottenrott
Ein gezieltes Krafttraining zum Ausdauersport trägt wesentlich zur Verletzungsprophylaxe, zur Verbesserung der Gesamtkonstitution und der allgemeinen Leistungsfähigkeit bei. Überbeanspruchungen des Stütz- und Bewegungssystems und typische Beschwerdebilder wie der Rückenschmerz des Langstreckenläufers können vermieden werden, denn eine kräftige Muskulatur ist leistungsfähiger und kann die mechanische Belastung auf die Gelenke reduzieren. Stoßbelastungen wie beim Laufen und Springen werden über die Muskulatur effizienter gedämpft. Die verletzungsbedingten Auszeiten werden im Jahresverlauf minimiert, der Leistungsaufbau wird nicht ständig unterbrochen, so dass die Ausdauerfähigkeit stabil auf das Trainingsziel hin entwickelt werden kann.
Kraft: Leistungsgrundlage in den Ausdauersportarten
Einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der Leistungsfähigkeit des Ausdauersportlers hat das Niveau der Muskelkraft. Ein Krafttraining, abgestimmt auf die Anforderungen in der Ausdauersportart trägt zu einer ausgewogenen Belastbarkeit sämtlicher Funktionssysteme bei und bildet so einen wirksamen Ausgleich zum Ausdauertraining. Muskuläre Dysbalancen, Überbeanspruchungen und Verletzungen können durch ein gezieltes Krafttraining vorgebeugt und Leistungsschwächen im Bewegungssystem ausgeglichen werden. Das Krafttraining des Ausdauersportlers muss die Anforderungen der Sportart berücksichtigen, um leistungswirksam zu sein. Besonders ältere Ausdauersportler sollten ganzjährig ein Krafttraining absolvieren, um dem mit dem Alter zunehmendem Muskelabbau entgegenwirken. Für ambitionierte Wettkampfsportler ist ein sinnvoller Zeitpunkt zur Entwicklung von Kraftfähigkeiten die allgemeine Vorbereitungsperiode. Das vielfältige Angebot moderner Fitnessstudios mit den Schwerpunkten Kardiotraining an Ausdauerfitnessgeräten, Muskeltraining an Kraftgeräten, Rumpfkrafttraining und Group-Fitness drängen sich da geradezu auf.
Methodischer Aufbau des Krafttrainings
Ein Rumpfkrafttraining sollte ganzjährig durchgeführt werden, denn die Rumpfmuskulatur hat im Ausdauersport vielfältige Funktionen zu erfüllen:
- Wiederlagerfunktion d.h., die Rumpfmuskulatur stabilisiert das Becken und den Rumpf im Bewegungszyklus, um Ausweichbewegungen zu minimieren.
- Kraftübertragungs- und Kopplungsfunktion, d. h., die Rumpfmuskulatur überträgt die in Armen und Beinen entwickelte Kraft über Muskelschlingen vortriebswirksam.
- Schutzfunktion, d.h., eine kräftige Rumpfmuskulatur entlastet den Bewegungsapparat, insbesondere die Wirbelsäule, und schützt im Sinne eines Muskelkorsetts vor Fehl- und Überbeanspruchungen.
Eine chronische Fehlbelastung der Wirbelsäule kann eine ganze Reihe von Beschwerdebildern, wie Verspannungen und Verhärtungen der Muskulatur, sowie Ischiasbeschwerden hervorrufen. Die Rumpfmuskulatur muss so kräftig und ermüdungswiderstandsfähig sein, dass sie die genannten Aufgaben und Funktionen über die gesamte Belastungsdauer einer Trainingseinheit bzw. eines Wettkampfes wahrnehmen kann. Rumpfkräftigungsübungen sollten deshalb wöchentlich mindestens zweimal vor oder nach dem Ausdauertraining durchgeführt werden.

Altersklassentriathlet Martin Zülch beim Rumpfkrafttraining (Seitstütz mit Beinheben)
Das Kraftausdauertraining bildet das Fundament für das intensivere Gerätetraining zum Muskelaufbau. Hierbei werden mittlere Krafteinsätze mit hohen Wiederholungszahlen (20-40) trainiert. Ziel ist es, die lokale Muskelkraftausdauer zu verbessern und eine Gewöhnung an das Gerätetraining zu erreichen, um Überbeanspruchungen oder Verletzungen vorzubeugen. Dazu sind mindestens 10 Trainingseinheiten über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen erforderlich.

Abbildung: Methodischer Aufbau des Krafttrainings für den Ausdauersportler (Hottenrott & Neumann, 2020)
Das Muskelaufbautraining bzw. Hypertrophietraining schließt unmittelbar an das Kraftausdauertraining an. Ziel ist die Vergrößerung des Muskelquerschnitts (MQ-Training). Hierbei wird über den Eiweißanbau eine Dickenzunahme der einzelnen Muskelfaser erreicht. Ein dickerer Muskel kann zwar eine höhere Kraftleistung im Einzelzyklus entfalten, die maximale aerobe Stoffwechselrate nimmt jedoch ab, d.h., der kräftige Muskel ist nicht mehr so ausdauernd. Zu viel Muskelmasse wirkt sich ungünstig auf das Last-Kraft-Verhältnis und die passive Beweglichkeit aus. Aus diesem Grund sollte das Hypertrophietraining nicht mit sehr langsamer Bewegungsgeschwindigkeit bis zur vollständigen Erschöpfung des Muskels durchgeführt werden. Ein „Brennen“ in der Muskulatur wäre zu vermeiden, um einer maximalen Übersäuerung des Muskels entgegen zu wirken. Dies betrifft vor allem die Muskelgruppen, die in der Ausdauersportart für die Fortbewegung eingesetzt werden, also beispielsweise für den Läufer die Streckschlinge der unteren Extremität. Ein Muskelaufbautraining in der Beinpresse sollten folglich Läufer mit zügiger bis explosiver Bewegungsausführung in der Streckphase durchführen.

Altersklassentriathlet Martin Zülch beim Muskelaufbautraining
Ein Schnellkraft-, Reaktivkraft- oder Maximalkrafttraining kann nach einer 4-6wöchigen Muskelaufbauphase erfolgen. Mit diesem Training erfolgt zugleich eine Verbesserung der intra- und intermuskulären Koordination, d. h., das zeitliche und räumliche Zusammenspiel einzelner und mehrerer Muskelfasern wird optimiert. Das Schnellkraft- und Reaktivkrafttraining wird im Ausdauersport meist sportartspezifisch als Sprungkrafttraining ohne Nutzung von Krafttrainingsgeräten durchgeführt.
Die Ansprechbarkeit der Muskulatur auf Krafttrainingsreize ist bei jedem Sportler unterschiedlich und hängt u.a. von der Muskelfaserverteilung (Anteil an schnell und langsam kontrahierenden Fasern) oder dem hormonellen Status des Sportlers ab. Einige Sportler reagieren auf ein Muskelaufbautraining mit einer starken Hypertrophie (Muskeldickenwachstum). Dies kann sich kontraproduktiv auf die Ausdauerleistungsfähigkeit auswirken. Ein Maximalkrafttraining sollte nur unter Anleitung eines Trainers durchgeführt werden. Auf achsengerechte Belastungsformen und eine korrekte Bewegungsausführung ist unbedingt zu achten.
Hinweise für die Trainingspraxis
Für das Krafttraining an Geräten sollten Ausdauersportler einige Punkte beachten:
- Das Krafttraining an Geräten beginnt erst nach einem mindestens 10-minütigem Aufwärmen auf dem Laufband, Fahrradergometer oder Stepper.
- Die Kraftgeräte sind auf die Körperproportionen so einzustellen, dass die Drehpunkte der Geräte mit denen der Körpergelenke übereinstimmen und eine achsengerechte Belastung gesichert ist.
- Führen Sie zunächst ein Kraftausdauertraining mit hohen Wiederholungszahlen und hoher Bewegungsfrequenz über 2-3 Wochen durch, bevor Sie mit einem Hypertrophie- oder Maximalkrafttraining starten.
- Vermeiden Sie maximale Gelenkendstellungen (Knie- oder Ellbogengelenke nicht durchstrecken).
- Vermeiden Sie eine Rundrücken- oder Hohlkreuzhaltung. Entlasten Sie stets die Wirbelsäule, d. h., trainieren Sie nach Möglichkeit mit geradem Rücken unter aktiver Anspannung der Bauchmuskulatur.
- Konzentrieren Sie sich auf eine ruhige und gleichmäßige Atmung und vermeiden Sie eine Pressatmung beim Überwinden höherer Lasten.
- Trainieren Sie Agonisten und Antagonisten in einem funktionell ausgewogenen Verhältnis. Damit können Sie muskulären Dysbalancen entgegenwirken.
- Ein Krafttraining an Geräten sollte nicht nach einer ermüdenden Ausdauereinheit durchgeführt werden. Die Muskulatur und die passiven Strukturen (Bänder, Sehnen und Gelenke) sind in ermüdetem Zustand verletzungsanfälliger.
- Achten Sie auf eine ausreichende Eiweißversorgung im Anschluss an das Krafttraining. Ältere Sportler sollten 1,6-1,8 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag aufnehmen.
Literatur:
Hottenrott, K., & Neuman, G. (2020). Trainingswissenschaft – Ein Lehrbuch in 14 Lektionen. Meyer & Meyer: Aachen.
Univ.-Prof. Dr. Kuno Hottenrott
Direktor für Wissenschaft und Lehre
Deutschen Berufsakademie Sport und Gesundheit
Email: kuno.hottenrott@dba-baunatal.de
In einer aktuellen Studie wurde gezeigt, dass hohe Wdl mit geringeren Lasten im Vergleich zu geringen W. mit höheren Lasten ähnliche Effekte hervorrufen
Ausdauerfitnessgeräte
Die modernen Ausdauerfitnessgeräte bieten alle die Möglichkeit nach verschiedenen Programmen zu trainieren:
- Dauertraining auf unterschiedlichen Intensitätsstufen
- Stufentraining mit systematisch ansteigenden und wieder abfallenden Belastungsintensitäten
- Automatikprogramm oder Fahrtspiel mit zufälligem Wechsel von Dauer und Intensität.
Jedes Trainingsprogramm lässt sich auf die individuelle Leistungsfähigkeit programmieren. Der Monitor informiert über Herzfrequenz, Zeit, Strecke, Geschwindigkeit oder Leistung sowie durchschnittlichen Kalorienverbrauch.
Stepper:
Am Stepper wird das Treppensteigen simuliert und vor allem die Kraftausdauer der Bein- und Gesäßmuskulatur trainiert.
Ruderergometer:
Rudern zählt zu den anspruchsvolleren Bewegungsformen. Die zeitlich richtige Koordination von Armen und Beinen und der dosierte Krafteinsatz müssen erst erlernt werden. Beim Rudern ist darauf zu achten, dass der Rücken in der Zugphase aufgerichtet wird. Stellen Sie vor dem Training die Position entsprechend ein. Lassen Sie sich auch im weiteren Verlauf des Trainings immer mal wieder von einem Trainer auf die richtige Bewegungsausführung hin kontrollieren.
Fahrradergometer:
Auf dem Fahrradergometer wird vor allem die Streck- und Beugeschlinge der Bein- und Hüftmuskulatur trainiert. Wichti ist die richtige Sitzposition, um die Belastung auf das Kniegelenk und den Rücken möglichst gering zu halten. Stellen Sie die Sattelhöhe so ein, dass das Bein (Ferse steht auf dem Pedal!) in unterer Kurbelstellung durchgestreckt ist. Eine hohe Tretfrequenz (über 80 U/min) bei geringerem Widerstand ist für die Gelenkbelastung und Bewegungsökonomie günstiger als eine niedrige mit hohem Widerstand. Wollen Sie hingegen verstärkt die Kraftausdauer trainieren, sind geringere Tretfrequenzen und höhere Widerstände zu wählen. Für das Fitnesstraining ist ein Wechsel von Tretfrequenz und Widerstand im Sinne eines Fahrtspiels besonderes effektiv.
Laufband:
Beim Laufen im Freien, insbesondere beim Bergablaufen, treten hohe Stoßbelastungen (high impact) mit starker Beanspruchung des Stütz- und Bewegungssystems auf. Laufen auf modernen Laufbändern garantiert wegen der neuen Stoßabsorbtionstechnik ein gelenkschonendes und wirbelsäulenfreundliches Training. Die Bewegungsgeschwindigkeit kann vom Walkingtempo bis zum Renntempo variiert werden. Es bietet Laufanfängern hervorragende Möglichkeiten für den Einstieg in das Ausdauertraining. Kontrolliert lässt sich eine ökonomische Lauftechnik erlernen. Das Laufband ist beliebt für das Warm-up, aber auch ein geeignetes Gerät, um die Ausdauer und den Fettstoffwechsel zu trainieren. Durch das Einstellen steilerer Neigungswinkel kann außerdem die Kraftausdauer trainiert werden. Die Stoßbelastungen auf das Bewegungssystem sind im Vergleich zum flachen Laufen geringer, der Energieumsatz und die Beanspruchung des Herz-Kreislaufsystems nehmen hingegen zu.
Skilanglauftrainer:
Skilanglauftrainer sind ausgezeichnete Fitnessgeräte für ein Ganzkörpertraining. Der harmonische und gleitende Bewegungsablauf ist schonend für Gelenke, Bänder und Sehnen. Durch den gleichzeitigen Einsatz aller großen Muskelgruppen werden im Vergleich zu anderen Fitnessgeräten die meisten Kalorien pro Zeiteinheit umgesetzt.
Climber:
Beim Climber wird das Klettern an Wänden oder das Hinaufsteigen auf Leitern simuliert. Durch den Einsatz von Armen und Beinen wird beim Aufsteigen die gesamte Muskulatur eingesetzt. Beim Climben ist es möglich, entweder die Beine wie am Stepper oder die Arme beim Hochziehen verstärkt einzusetzen. Unterschiedliche Handgriffpositionen (Seit-, Kamm-, Ristgriff) ermöglichen zudem ein gezieltes Training unterschiedlicher Armmuskeln.