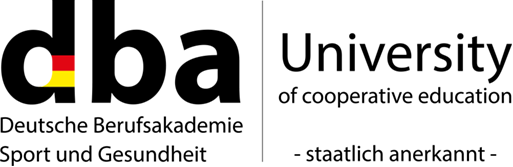Veganes Bodybuilding
Einführung
Während Fleisch noch vor vierzig Jahren in populären Fernseh-Werbespots als ein Stück Lebenskraft angepriesen wurde, führen Schulküchen inzwischen vegetarisches Essen für Schulkinder ein und stoßen dabei auf massive Kritik durch offenbar „wertkonservative“ Eltern (33). Dabei ist die vegetarische Ernährung noch vergleichsweise moderat, denn längst scheint die vegane Ernährung auf dem Vormarsch zu sein. Bis vor etwa fünf Jahren noch tat man vegane Ernährung, also den völligen Verzicht auf jedwede tierische Nahrung, als skurrile Marotte von ein paar durchgeknallten Außenseitern ab. Heute indes stößt man auf riesige Werbetafeln für vegane Lebensmittel und findet selbst in den allerorts üblichen Supermärkten eine immer größere Auswahl an veganen Alternativen zu Fleisch, Wurst, Milch und Käse. Der renommierte deutsche Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Claus Leitzmann beschreibt in einer aktuellen Analyse des Phänomens die unterschiedlichsten „Splittergruppen“, welche die vegane Ernährung inzwischen hervorgebracht hat. Das Spektrum reicht von „Pudding-Veganern“ über „Fruganer“, „Roh-Veganer“, „Honig-Veganer“, „Pesco-Veganer“ – letztere verzehren sogar gelegentlich Fisch – bis hin zu „Freeganern“, denen es um „die Kritik und Abwehr von der kapitalistischen Konsum- und Wegwerfgesellschaft“ geht. (39) Denn Essen hat und hatte noch nie nur mit der Zufuhr von Nährstoffen zu tun, sondern immer auch mit Kultur, mit Politik, Wirtschaft und den Wertvorstellungen, um die es beim Essen und Trinken geht. Längst gibt es auch vegane Proteinpulver!
Womit wir beim Bodybuilding wären, denn abgesehen von Anhängern dieses immer schon umstrittenen Sportes hat sich früher kaum jemand für Proteinpulver als Nahrungsergänzung interessiert. Dass Proteinpulver jetzt schon in „stinknormalen Supermärkten“ verkauft wird, darf man getrost als Indiz dafür werten, dass der Absatz boomt! Denn obwohl sich immer mehr vermeintliche „Spitzenbodybuilder“ inzwischen zu Tode dopen ist Bodybuilding keineswegs „im Sinkflug“ – ganz im Gegenteil, die Teilnehmerzahlen bei Bodybuilding-Meisterschaften boomen in nie gekanntem Ausmaß und auch die Anhängerschaft des reinen „Freizeit-Bodybuildings“ wächst offensichtlich immer mehr. Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines gewaltigen Wertewandels in der Bodybuilding-Welt. Immer mehr setzt sich die Einsicht durch, dass auch im Bodybuilding „mehr“ nicht gleich „besser“ ist, dass man Bodybuilding auch ohne Medikamente betreiben kann und dass ein muskulöser Körper nicht unbedingt immer schöner wird, wenn man immer mehr Muskelmasse und immer dickere Venen auf ihn draufpackt! Selbst auf Wettkampfebene ist das Bodybuilding inzwischen in einem gravierenden Umbauprozess begriffen. Das dezimiert die Teilnehmerzahlen nicht etwa, sondern lässt sie im Gegenteil sogar gewaltig anschwellen! In die neu geschaffenen Kategorien des „Classic Bodybuilding“ oder „Fitness- und Figur-Bodybuilding“ strömen junge Leute, die weder „Monstermasse“ noch „messerscharfe Definition“ mitbringen, dafür aber Ästhetik, Gesundheit, Lebensfreude und Offenheit für die Fragen der Zeit statt weltabgewandter Dumpfheit, weil man ja außer für Training, Essen, Schlafen und Arbeiten keine Zeit und keine Energie mehr hat, sich noch um irgendetwas sonst außer sich selber zu kümmern. Solche hoffnungsvollen jungen Leute aber bringen auch neue Ideen mit ins Bodybuilding, und eine solche Idee ist die von der veganen Ernährung.
Wie alle Ideen, die einst jung, hoffnungsvoll und unschuldig das Licht der Welt erblickten, um die Dinge zum vermeintlich Besseren zu wenden, läuft jedoch auch die Idee der veganen Ernährung Gefahr, in ganz unterschiedliche Richtungen gedrängt zu werden. Prof. Dr. Claus Leitzmann, der Nestor der deutschen Ernährungswissenschaft, formuliert wörtlich: „Der häufigste Grund für eine vegane Ernährung ist ethischer Natur. Danach werden gesundheitliche Gründe genannt.“ (39) Nun machen die Wirren der Zeit gerade in den Wochen der Entstehung dieses Buches grandios vor, dass sich mit jeder Idee Ansehen, Macht und Geld erwirtschaften lässt, wenn man sie sich skrupellos unterwirft. Auch Bodybuilding bildet da keine Ausnahme, sondern ist geradezu ein Paradebeispiel. Spätestens ab den 1960er Jahren wurde Bodybuilding skrupellos von den „Stoffhändlern“ okkupiert, die mit dem Schwarzhandel von Anabolika und sonstigen Medikamenten zu sehr viel Geld kamen und sich einen Teufel darum scherten, dass sie das Bodybuilding dabei regelrecht kaputt machten, indem sie die Idee hineintrugen, dass es „ohne Stoff nicht geht“ und damit den Absatzmarkt für ihren „Stoff“ regelrecht erschufen. Ich habe erlebt, dass mir der Wertungsrichter einer Weltmeisterschaft, bei der ich auf der Bühne stand, in einer Wettkampfpause vorschlug, mit ihm gemeinsam einen Händlerring für Wachstumshormon-Präparate in Deutschland zu organisieren – ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Presse deutschlandweit vor diesen Schwarzmarktpräparaten warnte. Als ich diesem „Herrn“ (Akademiker, gepflegte Manieren, multilingual) eröffnete, dass ich nicht dope, reagierte er völlig erstaunt: „Aber das machen doch alle…“ Er stützte einen ganzen Bodybuilding-Weltverband ins Chaos.
Man muss aber gar nicht in die illegalen Abgründe des Dopingsumpfes vorstoßen, um diese Mechanismen zu begreifen. Frei nach dem Motto des großen Bertolt Brecht „Was ist schon das Ausrauben einer Bank gegen die Gründung einer Bank!“ bietet auch die ganz legale Welt des freien Marktes genügend Möglichkeiten, um jede noch so gut und altruistisch gemeinte Idee aufzugreifen und gewinnbringend so lange auszubeuten, bis sie in ihr Gegenteil verkehrt und unglaubwürdig geworden ist. Eugen Sandow, der im ausgehenden 19. Jahrhundert die Idee des Bodybuildings in die Welt setzte, würde sich wohl im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was das moderne Profibodybuilding aus seinen Idealen von einem starken, gesunden und ästhetischen Körper gemacht hat! Dass es auch hier inzwischen „Gegenbewegungen“ wie das Natural-Bodybuilding oder „Fitness- und Figur-Bodybuilding“ mit einem gewaltigen Zulauf gibt, ist aus meiner Sicht Grund zur Hoffnung. Doch auch hier zeichnen sich längst schon wieder unterschiedliche Strömungen ab. Bereits ein Blick auf die Zersplitterung der Vereinslandschaft des Bodybuildings in Österreich, Deutschland und der Schweiz illustriert, was gemeint ist.
Nicht anders sieht es bei der veganen Ernährung aus. Umweltschutz, Gesundheit und Tierwohl sind zentrale Themen der öffentlichen Debatte um die Ausrichtung der Politik geworden. Vegane Ernährung wird inzwischen auch von wissenschaftlichen Autoritäten ganz ernsthaft als eine Möglichkeit zur Lösung drängender Zeitprobleme diskutiert und immer mehr Menschen überdenken aus dieser Sicht der Dinge ihr Ernährungsverhalten. Und natürlich birgt diese Entwicklung das Potenzial zur Vermarktung – ebenso aber auch das Risiko, dass man „ins moralische Abseits gerät“, wenn man sich ihr verweigert. Wie auch immer, die Entwicklung der Dinge ist nicht mehr zu übersehen: Inzwischen prangt der Hinweis „vegan“ auf immer mehr Lebensmittelverpackungen und längst gibt es auch vegane Restaurants und vegane Gerichte in den Bistros der Deutschen Bahn. Aber auch Sportinteressierte sind im Fokus des Interesses – die veganen Proteinpulver in den Supermarktregalen wurden bereits erwähnt. Bücher mit Titeln wie „Vegan in Topform“ oder „Vegan zur Höchstleistung“ fluten den Markt. Schon zeichnen sich auch die ersten Grabenkämpfe ab. Ärzte punkten mit ihrer Fachkompetenz bei der Beurteilung von Gesundheitsfragen mit Buchtiteln wie „Vegan. Die gesündeste Ernährung aus ärztlicher Sicht“, obwohl ihre Kollegen aus der Kinderheilkunde womöglich noch immer besorgt das Jugendamt informieren, wenn sie Kunde davon erhalten, dass Eltern ihre Sprösslinge vegan ernähren. Während sich Autoren wie der bereits erwähnte Nestor der deutschen Ernährungswissenschaft Prof. Dr. Claus Leitzmann mit Büchern wie „Veganismus. Grundlagen, Vorteile, Risiken“ bereits im Titel erkennbar um wissenschaftliche Ausgewogenheit bemühen, ist der in Ernährungsfragen seit Jahrzehnten einschlägig bekannte Lebensmittelchemiker Udo Pollmer gemeinsam mit einigen Gesinnungsgenossen längst schon wieder als Warner mit einem wie gewohnt sehr unterhaltsam geschriebenen Bestseller auf dem Buchmarkt unterwegs, dessen Titel bereits den Inhalt zusammenfasst: „Don’t go Veggie! 75 Fakten zum veganen Wahn!“ Ganz zeitgemäß tritt Udo Pollmer inzwischen auch im Internet in Erscheinung, denn die Jugend ist mehrheitlich digital unterwegs. Ob junge Bodybuilder beiderlei Geschlechts mit dem inzwischen ergrauten Udo Pollmer noch etwas anzufangen wissen entzieht sich freilich meiner Kenntnis. Vermutlich aber interessieren sie sich weniger für wohlbeleibte ältere Herren, sondern mehr für junge Bodybuildingstars. Kein Wunder also, dass die ersten veganen Bodybuilder bereits auf Youtube unterwegs sind.
Was von alldem zu halten ist – genau darum soll es in diesem Buch gehen.
Als zweifach promovierter Lehrer an einer medizinischen Fachschule fühle ich mich primär der Wissenschaft verpflichtet und stehe jeder Form von Ideologie ausnehmend kritisch gegenüber. Lange vor meiner wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Aspekten des Bodybuildings habe ich ganz persönliche Erfahrungen gesammelt, die ich hier ebenfalls einbringen werde. Da ich seit 1974 Krafttraining betreibe, seit über 40 Jahren Wettkampfbodybuilder bin und mich seit Mitte der 1990er Jahre ganz bewusst vegetarisch ernähre, kommt da Einiges zusammen. Die kommerziellen Aspekte des Bodybuildings lernte ich vor allem dadurch kennen, dass ich mich ab den 1990er Jahren auch als Funktionär bei insgesamt drei Bodybuilding-Verbänden engagierte, Wettkämpfe bis hin zu einer Europameisterschaft organisierte und durch meine Teilnahme an internationalen Zusammenkünften Gelegenheiten hatte, hinter die Kulissen der Bodybuilding-Szene zu sehen.
Als der Gründer und Leiter des Novagenics-Verlages Klaus Arndt mich vor einigen Monaten anrief und mir vorschlug, ein Buch über veganes Bodybuilding zu schreiben, sagte ich sofort begeistert zu, denn Bodybuilding ist nach wie vor mein „Lebensthema“, über das ich noch immer und auf allen Ebenen nachdenke und wo ich mich noch immer einmische, nicht zuletzt als Teilnehmer an Wettkämpfen – mittlerweile in der Seniorenklasse – und als Buchautor.(26)
Bereits einige Zeit nach dem Anruf von Klaus Arndt verfiel ich jedoch ins Grübeln. Denn eine Reihe von Fragen stellte ich mir erst, als ich schon am Manuskript saß. Veganes Bodybuilding ist ein Thema an der Schnittstelle von Biochemie, Sportphysiologie und Sozialwissenschaften – und das Ganze soll am Ende auch irgendwie unterhaltsam, gut lesbar und verständlich sein! Glücklicherweise versuche ich diesen Spagat nicht zum ersten Mal.
Wie sich die Zeiten ändern
Neues Bodybuilding und neue Ideen
Wissenschaft hat ja auch irgendwo den ursprünglichen Zweck, sich im Leben besser zurechtzufinden, so dass man letztlich aus so ziemlich jedem Aspekt des Daseins eine Wissenschaft machen kann, wenn man sich nur lange und gründlich genug mit ihm beschäftigt. Mit Bodybuilding ist das nicht anders. Als ich vor ungefähr 20 Jahren den mir aberwitzig erscheinenden Entschluss fasste, Bodybuilding zum Thema meiner Doktorarbeit zu machen, genierte ich mich fast inmitten der anderen sportwissenschaftlichen Doktoranden der Universität Chemnitz. Seit ich als Zwölfjähriger mein Krafttraining mit täglichem Liegestütztraining begann, hatte ich zu hören bekommen, dass ich ein Spinner, Einzelgänger und Außenseiter bin und dass nur populäre Sportarten wie Fußball, Boxen oder Ringen „richtige Sportarten“ seien, denn nur das sah man im Fernsehen und nur darüber berichteten die Zeitungen. Sie berichteten zwar auch über andere Sportarten, aber für die gab es in der sächsischen Provinz, wo ich aufwuchs, nicht nur kaum Trainingsmöglichkeiten, man galt auch als Außenseiter, wenn man sich überhaupt dafür interessierte. Genau so ein Außenseiter wurde ich! Und dann stand ich gute zehn Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer mit dem Konzept für einen Fragebogen in der Hand in einem Seminargebäude der Universität Chemnitz und hörte einen Doktor der Sportpsychologie laut über den Flur ruft: „Wo is’n hier der Bodybuilder, der promovieren will?“ Da nahm mich offenbar jemand ernst, das Projekt endete erfolgreich. Unter solchen Umständen kann man sich schon mal in die Wissenschaft verlieben.
Wissenschaft steht jedoch oft im Ruf, lebensfern irgendwo in einem Elferbeinturm zu existieren, während die meisten Menschen im ganz realen Leben gezwungen sind, sich an ganz anderen Autoritäten zu orientieren. In der Kindheit sind das gewöhnlich die Eltern. Diese geben ihre tatsächlichen oder vermeintlichen Erkenntnisse über die Mechanismen des irdischen Daseins an die nächste Generation weiter, auch in Fragen der Ernährung. Interessant wird es, sobald Einflüsse von Freunden, Lehrern, Trainern oder anderen Bezugspersonen dazukommen, die möglicherweise ganz andere Auffassungen als die Eltern vertreten. Frage eines Jungen an seinen Schulfreund: „Betet ihr vor dem Essen?“ Antwort: „Nein, meine Mutti kocht ganz gut!“. Aus diesem Witz könnte man ein Soziologie-Seminar machen: Wieso wird in manchen Familien vor dem Essen gebetet? Wieso gilt es als selbstverständlich, dass die Mutti kocht und nicht der Vati? Wieso gilt es als „normal“, dass es „Gekochtes“ gibt statt Rohkost? Konfrontiert man Kinder und Jugendliche mit Erziehungseinflüssen, die solche Fragen aufwerfen, darf man sich nicht wundern, wenn sie diese Dinge je nach Sensibilität, Intelligenz und Eigensinn ganz unterschiedlich verarbeiten und zu ganz eigenen Schlussfolgerungen gelangen. Genau in diesem Spannungsfeld wachsen heute viele junge Bodybuilding-Enthusiasten auf. Nicht selten „kracht“ es dann mal daheim, wenn die „neumodischen Auffassungen“, die man aus dem Gym mit nach Hause bringt, mit den mehr oder weniger althergebrachten, „konventionellen“ Überzeugungen von Eltern, Onkeln und Tanten kollidieren.
Wie sich das anfühlt, weiß ich aus eigenem Erleben. Einer der Menschen, die meinen Eigensinn stets weniger entspannt sahen, war mein Vater. „Willst du gegen den Strom schwimmen?“, fragte er mich immer wieder – und nicht immer leise und gelassen. Das betraf nicht nur die Begeisterung für Bodybuilding statt für „normale“ Sportarten wie Fußball oder Boxen. „Mit dem Strom zu schwimmen“ bedeutete in der sächsischen Provinz auch: „Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!“ Der letzte Krieg lag noch keine 30 Jahre zurück, immer wieder bekam ich vom Hunger zu hören, der in den Jahren danach den Alltag bestimmte. Nicht aufzuessen galt als Sünde, sich satt essen zu können als Privileg, für das man der Welt Dank schuldete. Als ich als Fünfjähriger irgendwann keine Blutwurst mehr essen wollte, weil mir klar geworden war, dass sie Blutwurst heißt, weil sie aus Blut „gemacht wird“, erntete ich Gelächter. „Tiere sind doch zum Essen da!“, bekam ich zu hören. Und als ich einige Jahre später Vegetarier wurde, hieß es: „Wovon willst du denn stark werden, wenn du kein Fleisch isst?!“
Inzwischen sind knapp 50 Jahre vergangen und die Verhältnisse haben sich fast ins Gegenteil verkehrt. In meiner Jugend in der DDR gab es keine Gyms und ich galt als Sonderling, weil ich im Winter am vereisten Klettergerüst eines Kinderspielplatzes Klimmzüge und Dips trainierte. Heute hingegen ist es „in“, Mitglied eines Fitnessstudios zu sein, die es mittlerweile fast überall gibt (selbst in Werdau – unfassbar…). Fleisch zu essen ist dagegen ins Gerede geraten, während vegetarische und vegane Ernährung boomen wie nie zuvor. Der Strom hat die Richtung geändert.
Meine Mitautorin Mag. Sonja Fiala hat Ähnliches erlebt. Als vormals stark übergewichtige „Tochter aus gutem Hause“ litt sie immer unter ihren überschüssigen Pfunden und der daraus resultierenden Abwertung, fügte sich aber nicht in ihr Schicksal, sondern nutzte im Wien ihrer Jugend jede sich bietende Gelegenheit, ihre Figur mit Jogging, Gymnastik und schließlich mit Hilfe des langsam in Mode kommenden Frauen-Bodybuilding in den Griff zu bekommen. Allen Rückschlägen zum Trotz schenkte sie sich zu ihrem 50. Geburtstag die Teilnahme an ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf.
Auch Sonja hat sich schon vor Jahren – wenngleich aus anderen Gründen als ich – zu einer Ernährung ohne Fleisch, Wurst und Fisch entschlossen. Trotz ihrer anspruchsvollen Arbeit als Abteilungsleiterin im Wiener Magistrat und sechs Tagen Training pro Woche hat sie sich bereit erklärt, ein Kapitel zu diesem Buch beizusteuern, das ich so nicht hätte bringen können, denn Sonja hat ihr ganz eigenes Ernährungskonzept. Ohnehin ist Bodybuilding für Frauen ein Thema, bei dem Männer aus meiner Sicht nur sehr begrenzt mitreden können, sodass ich sehr froh darüber bin, Österreichs älteste Wettkampf-Bodybuilderin „mit im Boot zu haben“.
„Lupenreine Veganer“ sind wir jedoch nicht, das sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont. Aber man muss ja auch kein Insekt sein, um ein Buch über Insekten schreiben zu können, oder? Zudem haben wir gute Gründe dafür, den „Veganismus“ an der einen oder anderen Stelle auch durchaus kritisch zu sehen, trotz aller grundsätzlichen Sympathie. Auch diese Gründe sollen hier erläutert werden. Um alle Aspekte des Themas auch aus eigenem Erleben heraus möglichst gut beurteilen zu können, habe ich meine Ernährung zudem einige Wochen lang von vegetarisch auf komplett vegan umgestellt. Es war eine interessante Zeit. Aber der Reihe nach, fangen wir an.
Dr. Andreas Müller / Mag. Sonja Fiala