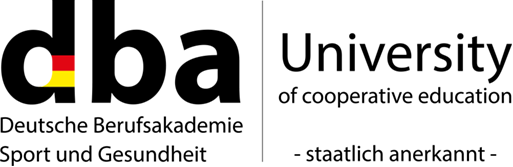Training mit Musik – Motivationshilfe oder Technik-Killer (Teil 2)
Dr. Sabine Nunius
Die eigene Körperwahrnehmung schulen
Überlastung droht auch dann, wenn die Ablenkung durch die Musik so groß wird, dass die körperlichen Reaktionen aus dem Blick geraten oder übergangen werden. Diesen Effekt habe ich in Indoor Cycling Kursen regelmäßig erlebt. Gerade neue Teilnehmer muss man in solchen Fällen oft eher bremsen als motivieren. Angefeuert durch die Gruppendynamik, treibende Beats und die generelle Atmosphäre geschieht es vor allem bei unerfahrenen Teilnehmern schnell, dass sie sich im Eifer des Gefechts so von den eigenen körperlichen Reaktionen ablenken lassen oder diese bewusst ignorieren, dass sie sich so regelrecht selbst „abschießen“. Glücklicherweise gehen derartige Fälle bei sportgesunden Menschen in der Regel gut aus. Allerdings ist diese Art des „Trainings“ weder sinnvoll noch für die Betroffenen angenehm, gerade wenn es im Anschluss, ausgelöst durch die Überanstrengung, zu Übelkeit, Muskelkrämpfen, nächtlicher Unruhe, etc. kommt. Gerade diejenigen Sportler, die bisher noch wenig Erfahrung mit musikgestütztem Training gemacht haben, sollten diesen Aspekt am Anfang besonders im Auge haben. Denn die Verlockung zu „overpacen“ ist bei dynamischen Playlists mit der eigenen Lieblingsmusik recht hoch. Das anfängliche Hochgefühl und die damit einhergehende Trainingsintensität oder
-geschwindigkeit bezahlt man jedoch häufig damit, die Einheit zu schnell oder zu hart anzugehen und zum Ende hin einen Einbruch zu erleben.
Darüber hinaus ist Training weit mehr als das automatische Abspulen von Bewegungen. Doch leider scheint, wenn man Sportler beim Training beobachtet, immer wieder genau das einzutreten. Egal ob in Gruppenkursen oder auf der Trainingsfläche sieht man regelmäßig Sportler, die mechanisch ihr Programm durchexerzieren und bei denen der Eindruck entsteht, sie seien in Gedanken vollkommen anderswo. Dieser Effekt kann durch Musik verstärkt werden. Ist diese Form der Ausführung eher Standard als die Ausnahme, hat das zur Folge, dass kein oder kaum Bewusstsein dafür entsteht, welche Muskelgruppen bei einer Übung aktiviert bzw. von ihr angesprochen werden sollen.
Ein klassisches Beispiel für diesen Fall: Ich wurde und werde in regelmäßigen Abständen darauf angesprochen, dass trotz regelmäßiger Squats keinerlei Verbesserung hinsichtlich der Gesäßmuskulatur stattfindet. Des Rätsels Lösung besteht meist darin, dass die betreffenden Sportler mit den Squats zwar eine Übung ausführen, von der sie gehört oder gelesen haben, dass sie die gewünschte Muskelgruppe anspricht, diesen Effekt aber nie selbst gespürt haben. Dann wird zum Beispiel vor allem der Vorfuß belastet und die Kraft in erster Linie aus der Muskulatur der Oberschenkelvorderseite geholt. Zudem erfolgt eine Kompensation des nicht oder nicht ausreichend aktivierten Gluteus durch andere Muskelgruppen, die dadurch überlastet werden. Besonders häufig habe ich dieses Phänomen bei Teilnehmern von Gruppenkursen erlebt, die über die Jahre hinweg zwar tausende an Kniebeugen ausgeführt, dabei jedoch keine über die Standardanweisungen hinausgehende technische Einführung erhalten und schon gar kein gezieltes Techniktraining absolviert hatten. In solchen Fällen lohnt es sich selbst bei langjährigen Sportlern, noch einmal zu den „Basics“ zurückzukehren und sie ein Gefühl dafür entwickeln zu lassen, wie sie selbständig einzelne Muskelgruppen ansteuern und aktivieren. Bei diesem Schritt ist die Musik hinderlich und sollte daher weggelassen werden. Gleiches gilt bei Formaten wie bestimmten Yogastilen, die speziell auf die Schulung der Eigenwahrnehmung ausgelegt sind. Auch hier ist Musik dem gewünschten Ergebnis abträglich.
Wettkampfvorbereitung unter realistischen Bedingungen
Wie bereits gezeigt kann Musik motivieren, von der Anstrengung ablenken und so indirekt die Leistung steigern. Das erleichtert eindeutig die ein oder andere harte Trainingseinheit und hilft, im Wettkampf selbst die letzten Kraftreserven zu mobilisieren. Allerdings sollte im Hinblick auf eine Wettkampfvorbereitung im Blick behalten werden, unter welchen Bedingungen die Veranstaltung letztendlich stattfindet. Das klingt trivial, wurde aber für Hobbyathleten bereits zur Herausforderung. So machte 2007 die Entscheidung des Organisationskomitees des New York Marathons Schlagzeilen, Musik bei der Teilnahme künftig zu untersagen. Auch in anderen Disziplinen müssen die Athleten im Wettkampf auf Musikunterstützung verzichten. Genau diese Gegebenheiten sollte in der Vorbereitung berücksichtigt und entsprechend trainiert werden, um Leistungseinbußen im Wettkampf zu vermeiden. Je nach Sportart kann es aber genauso umgekehrt vorkommen, dass Sportler mit einer erheblichen Geräuschkulisse konfrontiert werden, beispielsweise durch Fans und Zuschauer, durch parallel stattfindende Wettkämpfe oder eingespielte Musik. Wer davor ausschließlich mit Hilfe seiner Kopfhörer von der Außenwelt abgeschottet trainiert hat, läuft leichter Gefahr, in der Wettkampfsituation abgelenkt zu werden. Aus offensichtlichen Gründen ist es unmöglich, die tatsächliche Stadion- oder Hallenatmosphäre nachzustellen. Weiß man jedoch im Voraus, dass eine Ablenkung zu erwarten ist, lohnt sich ein Training, bei dem auf zusätzliche Abschottung verzichtet wird und „Störungen“ durch andere Trainierende nicht durch Musik ausgeblendet werden.
Musik sinnvoll eingesetzt – Orientierungshilfen für die Zusammenstellung des eigenen Soundtracks
Es zeigt sich: Training mit Musik hat ganz klar zwei Seiten. Wie in so vielen Fällen gibt es hier nicht die eine Wahrheit oder den einen richtigen Weg. Insbesondere im Breitensport ist deshalb in der Regel ein Mittelweg sinnvoll, das heißt, eine Kombination aus beiden Varianten. Auf diese Weise kann der Sportler die positiven Effekte der Musik nutzen wie etwa Motivation und bessere Stimmung, gleichzeitig aber einen Fokus auf korrekte Ausführung, Technik sowie Verbesserung der Eigenwahrnehmung setzen.
Bei der Zusammenstellung des persönlichen Soundtracks spielen die individuellen Präferenzen eine große Rolle. Darüber hinaus gibt es einige allgemeine Kriterien, die bei der Auswahl helfen können. Hier eine kurze Übersicht von Karageorghis und Priest bezüglich hilfreicher Charakteristika:[1]
- (a) starke, energetisierende Rhythmen
- (b) positive Songtexte mit Bezug zu Bewegung (z. B. “Body Groove” von The Architects Ft. Nana)
- (c) rhythmische Muster, die an die Bewegungsmuster der ausgeübten Sportart angepasst sind
- (d) stimmungsaufhellende Melodien und Harmonien
- (e) Assoziationen mit Sport, Training, Triumph oder dem Überwinden von Hindernissen
- (f) Musikstile und Idiome, die dem individuellen Geschmack des Sportlers entsprechen oder zu seiner kulturellen Sozialisierung passen
- Hinsichtlich des idealen Tempos findet sich bei Karageorghis die Empfehlung, sich auf einen Bereich zwischen 120 und 140 bpm zu konzentrieren. Ab einem Tempo von 145 scheint keine weitere Steigerung der Effektivität mehr vorzuliegen.[2]
Bei diesen Punkten handelt es sich um eine allgemeine Orientierungshilfe. Die tatsächliche Auswahl sollte selbstverständlich nach den eigenen Zielen, Vorlieben und Bedürfnissen ausgerichtet werden![3]
Für Fragen und weiteren Austausch steht die Autorin gerne unter sabine.nunius@sanu-training.com zur Verfügung.
[1] Academy, U. S. Sports. 2008. „Music in Sport and Exercise : An Update on Research and Application“. The Sport Journal (blog). 7. Juli 2008. https://thesportjournal.org/article/music-sport-and-exercise-update-research-and-application/.
[2] https://www.nytimes.com/2008/01/10/fashion/10fitness.html, abgeruf. 09.02.2023
[3] Für diejenigen, die tiefer in das Thema einsteigen möchten, eignen sich die Studien und Bücher von Professor Costas I. Karageorghis, der an der Brunel University in London zu diesem Thema forscht.