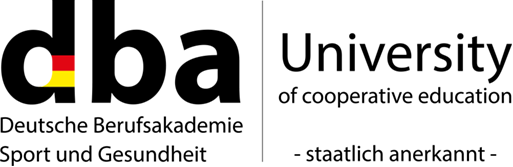GUTES TRAINING BEGINNT IM KOPF!
Autor: Matthias Beschnidt
Warum Bewegungen nicht „eingeschliffen“ werden – und „viel“ nicht immer „viel“ hilft.
Wer mit einem sportlichen Training beginnt, hat meist zuerst die sichtbaren, „physischen“, Effekte im Blick. Und so legen auch Übungsvorschläge und Trainer-Ausbildung zu Beginn einen besonderen Schwerpunkt auf die „mechanischen“ Aspekte der menschlichen „Hardware“.
Bei genauerer Betrachtung und ansteigender Leistungsfähigkeit gerät aber die „Software“ zunehmend in den Fokus. Denn es ist vor allem das Nervensystem, dass die Ansteuerung und Regulation der muskulären Arbeit leistet. Erst durch die komplexen Programme, nach denen Nerven die Muskelfasern miteinander koordinieren, entstehen nicht nur sportliche „Techniken“ sondern auch wirksame und wohldosierte Kraftentfaltung!
Es liegt also auf der Hand, dass diese ’neuronale‘ Programmierung der Nerven der entscheidende Faktor ist, um aus einem Anfänger einen Routinier oder gar Leistungssportler zu machen. Aber:
Wie werden die Nerven programmiert?
Und: Welche Fehler und Missverständnisse passieren, die eine gute Entwicklung verhindern?
An dieser Stelle bieten Sport- und Neurowissenschaft interessante Schnittmengen. Und zwar nicht nur in Form dicker Bücher oder langatmiger Studien. Sondern bereits in ganz praktischen Erfahrungen und Beobachtungen.
So verbinden sich die Nervenbahnen miteinander, die oft gemeinsam arbeiten (vgl. D. Hebb). Es entstehen Netzwerke, die komplexe Abfolgen in möglichst simple „short-cuts“ bündeln. Während ein Anfänger also noch über eine konkrete Technik nachdenken muss, sich mit Bewusstsein und Verstand Schritt für Schritt an die jeweilige Gelenkstellung herantastet, „spürt“ der Erfahrene Sportler eher die zu entfaltende Wirkung und lässt den Körper diesem Eindruck folgen.
In der Praxis sehen wir das vielfach an den oft stockenden und „unrunden“ Bewegungen von Anfängern, denen gegenüber die Techniken und Ausführungen von erfahrenen Athleten den Eindruck von „Leichtigkeit“ durch eine fließende Bewegung vermitteln. Als Trainer fragt man sich: „Wie kommt das zustande?“ Und noch mehr: „Wie kann ich diese Entwicklung unterstützen?“
An dieser Stelle wird meist aufgrund von mangelhafter Fachkenntnis auf Klischees zurückgegriffen. Und die sind oft irreführend oder gar falsch!
Wie bereits erwähnt, vernetzen sich Nerven erst Schritt für Schritt während eines Lernprozesses. Das heißt aber auch: Eine Bewegung kann keine wirkliche „Wiederholung“ einer anderen sein! Vielmehr muss es zwischen der einen Ausführung und der nächsten eine Veränderung geben. Ansonsten wäre die erste Ausführung ja bereits „perfekt“ (und Training nicht notwendig). Die Vorstellung also, irgendeine „Technik“ oder Bewegung schlicht -zigtausend Mal stumpf zu „wiederholen“ würde diese in irgendeiner Weise „einschleifen“, lässt sich weder anatomisch noch in der Funktionsweise des Nervensystems begründen (vgl. N.A. Bernstein).
Vielmehr baut das Nervensystem immer neue Bahnen, schnelle Direktleitungen, um eine als wichtig erkannte Handlung zukünftig besser und mit weniger Aufwand leisten zu können, auf. Das kann man sogar bei der Messung von Hirnströmen zwischen Anfängern und gestandenen Athleten sichtbar machen!
Einerseits verschiebt das Nervensystem Aufgaben der Bewegungssteuerung in untergeordnete Abteilungen, die das Bewusstsein entlasten (vgl. L. Jäncke). Andererseits verbessert sich die Synchronisation der beteiligten Rechenzentralen. Man kann so an der Veränderung der Hirnfrequenzen erkennen, ob ein Athlet ein Anfänger ist (dann sind es viele oft chaotische „Inseln“ der Aktivität) oder ein Erfahrener (dann ergibt sich eine gemeinsame „Welle“ über alle beteiligten Areale).
Der Unterschied zwischen Weltklasse-Athleten und Anfängern liegt also keineswegs bloß in der „PS“-Zahl der Muskulatur als vielmehr in der Leistungsfähigkeit ihres biologischen „Bord- Computers“ (Nervensystem)!
Was lässt das Nervensystem also besonders gut lernen?
Es sind die Variationen! Wie sich unschwer aus der Erkenntnis, dass eine Bewegung nie wirklich „wiederholt“ werden kann, erschließt, sind es nicht die immer stumpf wiederkehrenden Reize als vielmehr sich steigernde oder variierende Momente bei der Lösung ähnlicher Bewegungsaufgaben.
Auch das erkennt man schnell in der Praxis des Krafttrainings: Während „geführte“ Übungen an Trainingsgeräten schnell zu einer „Plateau“-Bildung und Stagnation der Leistungsentwicklung führen, kann „freies“ Hantel-Training hier nochmal ganz neue Reize setzen. Auch für den Laien erstaunlich ist der Umstand, dass die (scheinbar) selbe Bewegung im „geführten“ (Geräte-) oder „freien“ (z.B. Kurzhantel) Modus kaum dieselben Gewichtsleistungen hergibt. Nun, im Hinblick auf die unterschiedliche „Software“ der Bewegungsregulation ist das aber keineswegs überraschend.
Sogar in alten Kampfkünsten trug man diesem Effekt Rechnung: So wird im traditionellen Karate auf der Insel Okinawa von Alters her nicht nur Technik und Form geübt, wie es in den Medien oft zu sehen ist. Sondern es werden historische Kraftübungen mit asymetrischen Hanteln und mit Sand gefüllten Vasen (ähnlich Kettlebell) ausgeführt. Ziel ist dabei nicht ein pralles Muskelwachstum sondern die kontrollierte Stabilisierung wuchtiger Kräfte, die auf den Rumpf oder Arme und Beine wirken. Das erinnert doch stark an die Erfahrungen von Kraftsportlern im Freihantel-Training!
Fazit: Bewegungslernen erfolgt nicht durch „Einschleifen“ sondern durch „Aufbau“ von neuronalen Mustern. Während die Aufgabe für eine Bewegung selbstverständlich wiederholt werden kann und muss, kann der Körper aber dieselbe Bewegung (aus neuronaler Sicht) nicht wirklich „wiederholen“. Anpassungsprozesse und Lernerfolg werden nicht allein durch die Steigerung von Lasten erreicht, sondern durch zunehmendes Öffnen von geführten zu „freien“ Bewegungen. Reize, die variieren und auch Grenzbereiche der Möglichkeiten austesten, erzeugen einen stärkeren und länger anhaltenden Lerneffekt als stumpfe Wiederholungen derselben Aufgabe.