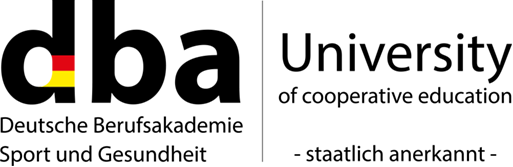Training mit Musik – Motivationshilfe oder Technik-Killer?
Dr. Sabine Nunius
Egal ob über Kopfhörer, tragbare Boxen oder festinstallierte Stereoanlage: Musikalische Untermalung ist aus dem Sport inzwischen fast nicht mehr wegzudenken. In der Groupfitness hat sich die Musikbegleitung dabei zum Standard entwickelt, Gruppenkurse sind ohne Hintergrundmusik kaum mehr vorstellbar. Die einzigen wenigen Ausnahmen bilden Formate wie Yoga und Entspannungskurse. Allerdings greifen auch sie zumindest punktuell oft auf Musik zurück, beispielsweise während der abschließenden Tiefenentspannung.
Befördert durch den technischen Fortschritt und die Entwicklung von immer kleineren und leichteren Geräten bietet sich ein ähnliches Bild auf der Trainingsfläche und im Hantelbereich. Auch hier sieht man häufig Sportler, die sich via Kopfhörer von Musik durch ihr Training begleiten lassen. Ebenso kommen einem mittlerweile die meisten Jogger „musikgestützt“ entgegen.
Die Gründe für diese Entwicklung dürften vielschichtig sein. Einerseits sind wir es durch unseren Alltag zunehmend gewöhnt, fortwährend von einer Geräuschkulisse umgeben zu sein. So gibt es wenige Kaufhäuser, Geschäfte, Cafés oder Restaurants ohne zumindest gelegentliche Hintergrundmusik. Hinzu kommt die fast allgegenwärtige Verfügbarkeit von einer enormen Auswahl an Titeln. Dank Technologien wie Bluetooth kann Musik komfortabler denn je abgespielt und konsumiert werden. Streamingdienste und Cloudservices tun ihr Übriges: Sie ermöglichen es auf höchst einfache Weise, Playlists zu personalisieren und nach den eigenen Wünschen zusammenzustellen. So lässt sich mühelos ein Soundtrack für so gut wie alle Situationen des Lebens kreieren, Sport und Training eingeschlossen.
Doch wie sinnvoll ist diese musikalische Begleitung? Wo können Sportler davon profitieren und in welchen Fällen ist Musik während des Trainings sogar kontraproduktiv? Der vorliegende Artikel möchte diesen Fragen nachgehen, sowie Impulse geben, an welchen Stellen Musik unterstützend wirkt und wo umgekehrt ein Verzicht sinnvoller ist.
Die Vorteile der Musik – wie und wo können Sportler profitieren?
Zweifelsohne birgt das Training mit Musik eine ganze Reihe von potenziellen Vorteilen. Die Musik bietet Ablenkung, dient als Motivationsquelle und kann sogar Leistung und Stimmung beeinflussen. Eine Studie von Terry et al. aus dem Jahr 2020 fasst die Wirkung von Musik folgendermaßen zusammen:
Music was associated with significant beneficial effects on affective valence (g = 0.48, CI [0.39, 0.56]), physical performance (g = 0.31, CI [0.25, 0.36]), perceived exertion (g = 0.22, CI [0.14, 0.30]), and oxygen consumption (g = 0.15, CI [0.02, 0.27]). No significant benefit of music was found for heart rate (g = 0.07, CI [−0.03, 0.16]). Performance effects were moderated by study domain (exercise > sport) and music tempo (fast > slow-to-medium). Overall, results supported the use of music listening across a range of physical activities to promote more positive affective valence, enhance physical performance (i.e., ergogenic effect), reduce perceived exertion, and improve physiological efficiency.[1]
Musik wird in Verbindung gebracht mit signifikanten förderlichen Effekten auf die affektive Valenz (g = 0.48, CI [0.39, 0.56]), physische Leistung (g = 0.31, CI [0.25, 0.36]), subjektiv wahrgenommene Anstrengung (g = 0.22, CI [0.14, 0.30]) und den Sauerstoffverbrauch (g = 0.15, CI [0.02, 0.27]). Keine signifikanten Verbesserungen ergaben sich im Hinblick auf die Herzfrequenz (g = 0.07, CI [−0.03, 0.16]).
Einige dieser zentralen, in der Studie angesprochenen Effekte sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.
Pump up the Jam! Mit Musik zu mehr Motivation und besserer Stimmung
Musik hat ganz eindeutig die Kraft, uns mitzureißen, uns Energie zu geben und unsere Stimmung schlagartig zu verändern. Diesen Effekt kennt wohl jeder aus eigener Erfahrung. Das Genre ist dabei nur von untergeordneter Bedeutung. Viel ausschlaggebender sind dagegen persönliche Präferenzen sowie biographische Hintergründe, etwa bestimmte Erinnerungen und Bilder, die wir mit einem Lied verbinden. In manchen Fällen reichen sogar schon die ersten Takte eines Stücks, um unsere Stimmung in kürzester Zeit zu heben. Dieser Effekt auf Motivation und Stimmung lässt sich gezielt für das Training nutzen.
Ein Aspekt, der bei diesem Mechanismus eine zentrale Rolle spielt, ist die Wechselwirkung zwischen Musik und unseren Emotionen, Gefühlen und Stimmungslagen. Sie wiederum haben einen starken Einfluss auf unsere Motivation und unser gefühltes Energielevel. Es konnte inzwischen belegt werden, dass Musik die Kraft hat, Emotionen zum Ausdruck zu bringen und sie sogar hervorzurufen.[2][3] Fühlen wir uns energetischer, fröhlicher und besser gestimmt, ist meist auch unsere Motivation für Aktivität und Dynamik ausgeprägter. Es liegt auf der Hand, dass fröhliche bzw. lebhafte Musik die Stimmung dabei tendenziell hebt, getragen-traurige Stücke uns dagegen eher melancholisch oder nachdenklich machen.
Wählen wir dynamische, energetisierende Tracks müssen wir zusätzlich berücksichtigen, welchen Effekt wir im Speziellen erzielen möchten. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob es uns darum geht, uns zu „pushen“ und uns etwa vor einem Wettkampf wach und hungrig auf das Messen mit der Konkurrenz zu machen, oder ob wir ohnehin schon so aufgeregt sind, dass wir eher etwas brauchen, das uns herunterbremst und unser Vertrauen in uns selbst und unsere Fähigkeiten stärkt. Die Musikauswahl orientiert sich an diesen Zielen.
Eine derartige Differenzierung hat zur Folge, dass Sportler, die ernsthaft mit Musik arbeiten, ein ganzes Repertoire an Playlists brauchen, die je nach Zweck eingesetzt werden. Diese lassen sich beispielsweise unterteilen in Zusammenstellungen zur Vorbereitung, Durchführung des Trainings oder Wettkampfs und anschließendem Cool-Down.
Um eine möglichst hohe Wirkung zu erzielen, müssen selbstverständlich die persönlichen Vorlieben eines Athleten berücksichtigt werden. Von der Mittelstreckenläuferin und zweifachen Goldmedaillengewinnerin Kelly Holmes wird beispielsweise berichtet, dass sie in ihrer Vorwettkampfroutine für die Olympischen Spielen in Athen vor allem auf Balladen von Alicia Keys wie „Fallin“ und „Killing Me Softly“ setzte, um sich in die gewünschte Stimmung zu versetzen.
Die Welt des Spitzensports bietet noch zahlreiche weitere Beispiele für derartige Vor-Wettkampf-Rituale. So gibt es viele Mannschaften, die immer zum gleichen Lied ins Stadion einlaufen. Andere Sportler lassen sich von einem speziell ausgewählten Song in den Wettkampf begleiten, wie etwa auf dem Weg in den Boxring. Bei den beiden letztgenannten Beispielen zeigt sich die emotionale Wirkung besonders stark. Sie ist so ausgeprägt (und auch darauf ausgelegt), dass sie auf die Zuschauer übergreift und mitunter fast stärker im Gedächtnis bleibt als der Wettkampf selbst: An die Details der Kämpfe von Henry Maske dürften sich heute wohl nur noch echte Fans erinnern, der Weg in den Ring zu „Conquest of Paradise“ ist dagegen auch weniger Box-Interessierten in Erinnerung geblieben.
Der Zusammenhang zwischen Emotionen, Stimmung und Motivation ist somit offensichtlich. Wie ausgeprägt und ausschlaggebend er für die tatsächlich erbrachte Leistung ist, bleibt jedoch offen – und wird es vermutlich teilweise auch bleiben. Denn Stimmung, Motivation und sportliche Leistung sind von zu vielen individuellen Faktoren abhängig, um die Auswirkung eines Teilaspekts verlässlich bestimmen zu können. Hinzu kommt, dass gerade im Bereich der Stimmung und Emotionen keine objektiven, in Zahlen ausdrückbaren Messungen möglich sind, auch wenn mitunter versucht wird, diese über Skalen oder ähnliches abzubilden. Letzten Endes beinhalten diese jedoch stets eine subjektive Komponente, die sogar innerhalb eines einzigen Tages schwanken kann.
Das Fazit an dieser Stelle lautet daher: Grundsätzlich KANN ein Sportler vom Einsatz von Musik in der Wettkampf- bzw. Trainingsvorbereitung profitieren. Wird die Musik als hilfreich empfunden, spricht nichts dagegen, sie in die eigene Routine zu integrieren. Dies gilt übrigens für alle Sportarten! Zwar konzentriert sich der Großteil der Studien auf den Ausdauerbereich, erste (kleine) Studien weisen jedoch darauf hin, dass vorbereitende Musik beispielsweise eine positive Wirkung auf die Leistung beim Bankdrücken hat und somit auch im Kraftsport sinnvoll eingesetzt werden kann.[4]
Musik und Flow-Erfahrungen
Ein weiterer Punkt, der bei der Motivation eine erhebliche Rolle spielt, ist das Erreichen von Flow-Zuständen. Diese erlauben es insbesondere, lange und anstrengende Trainingseinheiten oder Wettkämpfe durchzuhalten und die Anstrengung weniger stark wahrzunehmen. Musik kann hier insofern helfen, als durch individuell ausgewählte Musikstücke das Erreichen von Flow-Zuständen befördert wird.[5] Bezüglich der Belastbarkeit und tatsächlichen Stärke dieses Effekts sind einmal mehr weiterführende Studien vonnöten.
Dennoch dürften auch in diesem Fall viele Sportler die grundsätzliche Erfahrung schon einmal selbst gemacht haben, z. B. im Bereich des Ausdauersports. Vor allem bei repetitiven Bewegungsabläufen wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren können Tracks mit repetitiven Rhythmen und Melodien in einem auf die Aktivität abgestimmten, gleichförmigen Tempo helfen, einen Flow-Zustand zu erreichen. Setzt dieser ein, verschiebt sich unter anderem die gefühlte Zeitwahrnehmung. Dann kann es geschehen, dass die Zeit geradezu verfliegt und der Sportler scheinbar mühelos Kilometer um Kilometer zurücklegt. Lässt der Effekt nach, entsteht der Eindruck, aus einer Art Trance oder einem Traum aufzuwachen und in die Realität zurückzukehren.
Die Musik übernimmt dabei die wichtige Funktion des Taktgebers. Als solcher erleichtert sie es, den eigenen, gleichförmigen Rhythmus zu finden. Der äthiopische Langstreckenläufer Haile Gebrselassie dürfte eines der bekanntesten Beispiele dafür sein. Er ließ bei seinen Weltrekordversuchen im Stadium regelmäßig den Popsong „Scatman“ von Scatman John spielen, um in sein ideales Tempo zu finden.
Erschöpfung entgegenwirken – wie Musik helfen kann, länger durchzuhalten
Ein dritter Aspekt, der eng mit Motivation und Flow-Erleben verbunden ist, stellt die wahrgenommene Anstrengung dar. Erneut handelt es sich um ein Phänomen, das viele von uns wahrscheinlich kennen. Sei es bei einem Wettkampf, während eines anstrengenden Trainings oder wenn uns in den letzten Minuten eigentlich schon die Kraft verlässt und dann plötzlich genau die richtige Musik einsetzt und uns die Energie gibt, bis zum Schluss „durchzuziehen“.
Die kognitiven Prozesse, die bei der Wahrnehmung von Anstrengung und Erschöpfung stattfinden, sind mittlerweile wissenschaftlich erforscht. Hier wird häufig eine Verbindung zum Phänomen der Dissoziation hergestellt. Im klinischen Bereich bezeichnet Dissoziation den „Verlust der körperlich-psychischen Einheit der Person. Die Folge ist das Auftreten von psychischen Einheiten, die Handlungsabläufe durchführen, die der Person nicht bewußt werden bis hin zum Auftreten von selbständigen Unterpersönlichkeiten.“[6] Übertragen auf die Erfahrung beim Sport beziehen sich die Untersuchungen auf spezifische Qualitäten dissoziativen Erlebens. So findet eine Einschränkung der Aufmerksamkeit statt sowie eine veränderte Art der Wahrnehmung. Betroffene beschreiben diese oft wie in einem Film oder als ob sie sich selbst beobachten könnten. Diese Wirkung hat zur Folge, dass eine gewisse Distanzierung stattfindet und somit beispielsweise Anstrengung anders, in diesem Fall weniger stark, wahrgenommen wird. Die Abgrenzung zu vergleichbaren Zuständen wie Flow- oder Trance-Erlebnissen ist mitunter schwierig. Allen drei Zuständen gemein ist eine Veränderung der Wahrnehmung, die mit einer Art von Distanzierung und einem geänderten Realitätsempfinden einhergeht. Es existieren erste Vermutungen, dass die Fähigkeit zur bewussten Dissoziation, also das gewollte „Versinken“ in einer anderen Realität bzw. das Ausblenden bestimmter Aspekte bei manchen Sportlern ausgeprägter ist als bei anderen. Das prädestiniert sie möglicherweise dafür, Ausnahmeleistungen zu erbringen, bei denen es vor allem um die Überwindung körperlicher Grenzen geht.
Die Wirkung des dissoziativen Effekts scheint dann besonders ausgeprägt, wenn es um die gefühlte Anstrengung bei Belastung unter moderater Intensität geht. Studien berichten eine Verringerung der gefühlten Anstrengung um ∼ 10%. Je weiter die Intensität der Belastung steigt, desto stärker tritt die Bedeutung der Dissoziation in den Hintergrund und wird vom Aspekt der Motivation sowie der emotionalen Beeinflussung abgelöst. Das bedeutet, bei intensiven Belastungen nimmt der Sportler tendenziell die Aktivität als (sehr) anstrengend wahr, kommt jedoch durch die Musik in eine positive Grundstimmung und fühlt sich so motivierter und dynamischer. Zudem trägt die Musik dazu bei, von der gefühlten Anstrengung abzulenken und sie dadurch schwächer wahrzunehmen oder über längere Zeiträume aufrecht erhalten zu können.[7] Erneut sind weiterführende Studien notwendig, um die genauen Zusammenhänge sowie die tatsächlichen Effektstärke zu klären.[8] Es zeichnet sich jedoch ab, dass Musik grundsätzlich hilft, gleichförmige Aktivitäten länger durchzuhalten und eine positive Wirkung auf die Kraftausdauer sowie möglicherweise auf die Explosivkraft hat. Hinsichtlich der Maximalkraft zeigte sich dagegen keine Verbesserung.[9] Die vorliegenden Studien umfassen allerdings meist nur einen sehr kleinen Teilnehmerkreis und können daher nur als erste Hinweise und Tendenzen verstanden werden.[10][11] Von daher lautet das Fazit an dieser Stelle: Empfindet ein Sportler die Musik subjektiv als hilfreich, spricht nichts gegen einen wohldosierten Einsatz.
Musik als Instrument zur Förderung der Gesundheit?
Ein dritter Aspekt ist eher allgemeiner Natur und somit nur indirekt mit Training und sportlicher Leistung verbunden. Es handelt sich dabei um die potenziell gesundheitsfördernde Wirkung von Musik. Sie resultiert unter anderem daraus, dass beim Hören bestimmter Melodien und Rhythmen Endorphine ausgeschüttet werden. Die möglichen positiven gesundheitlichen Auswirkungen erstrecken sich auf viele Bereiche. So zeigten sich signifikante Effekte im Hinblick auf verminderte Ängstlichkeit, geringere Depressivität bei älteren Menschen sowie Verbesserungen im Rahmen der Schmerztherapie. Nähere Untersuchungen der Wirkung unterschiedlicher Musikstile lieferten einige erwartbare, bezüglich Heavy Metal aber auch überraschende Erkenntnisse:
„Die besten Musikeffekte sind durch klassische oder meditative Musik zu erreichen. Es gibt viele Komponisten, deren Musik zu einer Verbesserung der QoL [Anm.: Quality of Life = Lebensqualität] führt, besonders Bach, Mozart oder italienische Komponisten sind hier zu nennen. In eigenen Untersuchungen konnten wir zeigen, dass klassische Musik, Heavy Metal und Ruhe positive Effekte auf Herzfrequenz und Blutdruck hatten im Vergleich zu Popmusik der schwedischen Gruppe ABBA.“[12]
Betrachtet man die verfügbare Literatur, sticht immer wieder die subjektive Komponente hervor. Das heißt, die Wirkung der Musik wird in hohem Maße von den persönlichen Voraussetzungen des Probanden beeinflusst. Hierzu zählen neben biographischen Erfahrungen auch Alter und Herkunft bzw. kulturelle Sozialisierung. So löst nachvollziehbarerweise bei vielen Menschen solche Musik eine Stimmungsverbesserung aus, die sie an ihre Jugend erinnert und/oder mit positiven Erinnerungen verbunden ist. Diese Stimmungsverbesserung wirkt sich gleichzeitig auf das Allgemeinbefinden bzw. das subjektive Wohlbefinden aus. Dies kann zur Folge haben, dass Beschwerden weniger stark wahrgenommen werden und das Stresslevel sinkt. Ein reduziertes Stresslevel ist wiederum mit weiteren Verbesserungen verbunden, etwa im Bereich psychosomatischer Belastungen und Stresserkrankungen. Musik kann somit dazu beitragen, eine Positivspirale in Gang zu setzen, die auf unterschiedlichen Ebenen wirkt. Aufgrund dieser verstärkenden bzw. unterstützenden Wirkung ist Musiktherapie heute ein Bestandteil vieler Therapiekonzepte. Das Wirkprinzip als solches lässt sich auch im Alltag einsetzen und zur allgemeinen Steigerung des persönlichen Wohlbefindens nutzen. Bei der Auswahl der Musikstücke ist es sinnvoll, sich vor allem von persönlichen Präferenzen leiten zu lassen, anstatt allzu dogmatisch an Studienergebnissen festzuhalten. Sinnvoll ist vor allem das, was subjektiv gut tut!
Tempo, Technik, Wahrnehmung – wann Musik eher hinderlich ist
Die oben genannten Beispiele zeigen, dass sich Musik in vielerlei Hinsicht effektiv für Training, Wettkampfvorbereitung und Wettkampf einsetzen lässt. Allerdings gibt es auch Gründe, die dagegen sprechen, ausschließlich mit Musik zu trainieren. Diese sollen im zweiten Teil dieses Artikels beleuchtet werden.
Rhythmus und Betonung: Wenn der Takt aus dem Konzept bringt
Musik agiert wie bereits gezeigt als klarer Taktgeber. Dies ist vor allem für Sportarten mit repetitiven Bewegungsabläufen von großem Vorteil. Allerdings kommt die positive Wirkung der taktgebenden Funktion nur dann voll zum Tragen, wenn der Beat exakt auf das angepeilte Tempo sowie die Fähigkeiten des Sportlers abgestimmt ist. Ist das Tempo zu schnell oder zu langsam, verkehrt sich die Wirkung rasch ins Gegenteil. Viele Läufer haben diese Erfahrung sicher schon einmal gemacht: Rutschen versehentlich ein paar falsche Tracks in die Playlist, fühlt sich der Lauf plötzlich extrem zäh an oder der schnelle Beat verleitet so stark zur Tempoerhöhung, dass nach kurzer Zeit der „Mann mit dem Hammer“ kommt. Regelmäßig für Verwirrung sorgen zudem Songs im Dreivierteltakt, die uns aufgrund der wechselnden Betonung bei repetitiven Bewegungsabläufen leicht aus dem Konzept bringen. Dabei handelt es sich übrigens keineswegs nur um die klassischen Walzermelodien! Auch im (Hard-)Rockbereich gibt es einige Titel, die zumindest streckenweise den gewohnten 4/4-Takt verlassen und somit vom Marschrhythmus zum Schwungrhythmus wechseln. Dazu zählen beispielsweise „Nothing Else Matters“ von Metallica, „Desert Plains“ von Judas Priest und „Phantom of the Opera“ von Iron Maiden.
Abseits von 8er, 16er und 32er Blöcken: Wiederholungszahlen jenseits des 4/4 Takts
Ein weiterer Vorteil des Trainings ohne Musik ist die größere Flexibilität bezüglich der Wiederholungsanzahl. Prinzipiell ist es selbstverständlich möglich, jede denkbare Wiederholungszahl zu Musik auszuführen. In der Praxis gestaltet sich das allerdings schwierig, zumindest dann, wenn der Sportler über ein gewisses Musik- bzw. Rhythmusgefühl verfügt und dieses intuitiv in der Bewegung umsetzt. Die meisten gängigen Popsongs folgen einem 4/4 Takt. Der Anfang eines Musikbogens, in der Groupfitness auch als „große 1“ bekannt, gibt dabei eine feste Betonung vor. Bei der großen 1 handelt es sich um einen betonten Schlag, der in der Regel deutlich hörbar ist und beispielsweise den Wechsel von der Strophe zum Refrain einleitet. Innerhalb eines Musikbogens ist zudem oft der Beginn eines neuen Taktes leicht betont, hier spricht man von der „kleinen 1“. Musikalische Menschen folgen in der Bewegung intuitiv diesem Muster. Daraus ergeben sich Wiederholungszahlen von 8, 16, 32, etc.. Der Übungswechsel oder das Ende einer Übung erfolgt also immer nach einer musikalischen Einheit nach einer Wiederholungszahl, die ein Vielfaches von 8 darstellt. Auf diese Weise entsteht ein Flow – Formate, die auf eine Choreographie zurückgreifen funktionieren überhaupt nur so. Ungünstig wird diese Festlegung auf Wiederholungszahlen, wenn beispielsweise Maximalkraft trainiert werden soll oder es darum geht, herauszufinden, wie viele Wiederholungen ein Sportler maximal sauber ausführen kann. Hier ist es günstiger auf Musik zu verzichten und stattdessen den Fokus auf die Technik zu legen.
Trainieren „auf rechts“ – einseitige Belastung vermeiden
Die grundsätzliche Betonung des jeweils 1., 3., 5., etc. Schlags in der Musik hat darüber hinaus zur Folge, dass diese in der Bewegung nachgeahmt und damit eine Seite stärker belastet wird. Diese Wirkung lässt sich leicht selbst nachvollziehen! Dafür reicht es, zu einem gängigen Popsong auf der Stelle zu marschieren. Das Bein, das beginnt, gibt den Takt vor und wird dadurch stärker belastet. Entsprechend ergibt sich „marschieren auf rechts“ oder „marschieren auf links“ oder auch beim Indoor Cycling das Fahren „auf rechts“ oder „auf links“. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Betonung eine spürbare Wirkung im Hinblick auf den Muskelaufbau haben kann. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil der Übungsaufbau oder das Erlernen einer Figur häufig auf der gleichen Seite beginnt und anschließend lediglich auf die andere Seite übertragen wird, im Schnitt also weniger Wiederholungen stattfinden. In meinem Fall führte diese zwischenzeitlich dazu, dass die Oberschenkelmuskulatur einseitig deutlich stärker ausgeprägt war und ein Unterschied von 2 cm im Umfang vorlag! Wer regelmäßig mit Musik trainiert und dabei beispielsweise läuft oder radfährt, sollte daher darauf achten, beide Körperseiten gleichmäßig zu belasten und die „taktgebende Seite“ ab und an zu wechseln. Das lohnt sich schon allein aus koordinativen Gründen!
Geschwindigkeit und Intensität: die eigene Pace finden
Die durch den Takt vorgegebene Betonung ist jedoch nur ein Aspekt. Ein zweiter, fast noch wichtiger Punkt: das Tempo, das gleichzeitig die Geschwindigkeit der Übung vorgibt. Dieser Aspekt wird vor allem dann relevant, wenn es um komplexe Bewegungsabläufe und/ oder hochintensives Training geht. Diese Problematik kenne ich ebenfalls aus eigener Erfahrung aus meiner Zeit als Groupfitness-Instructor. Seit einigen Jahren erfreuten und erfreuen sich HIIT-Kurse großer Beliebtheit. Diese werden in aller Regel mit (lauter) Musik unterrichtet, bei der Signale innerhalb des Stücks – etwa ein Pfeifton oder eine Ansage – Beginn und Ende eines Intervalls angeben. Viele dieser Formate sind inzwischen online verfügbar und können leicht zu Hause durchgeführt werden, was ihre Beliebtheit steigert. Die Durchführung findet dann jedoch ohne Anleitung bzw. Korrektur durch einen Trainer statt.
Die Intervallzeiten variieren je nach Format leicht, gängig sind Zeiteinheiten, die auf den Tabata-Intervallen basieren. Es handelt sich dabei um vergleichsweise kurze Abschnitte, in der Regel zwischen 30 und 45 Sekunden. Die entsprechende Übung wird somit nur kurz, dafür jedoch mit maximaler Intensität ausgeführt. Ziel ist es, innerhalb der 30 bzw. 45 Sekunden eine deutliche Muskelermüdung zu erreichen. Die Intervalle werden hierfür in der Regel in mehreren „Runden“ durchgeführt, das heißt, eine längere Pause erfolgt erst nach dem vierten, fünften oder sechsten Durchgang. Aufgrund der hohen Intensität stellt sich bei den Teilnehmern gegen Ende einer Runde zunehmend Erschöpfung ein und die Konzentration lässt nach. Das ist trainingstechnisch erwünscht, birgt jedoch ein relativ hohes Verletzungsrisiko. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, dass das Tempo so gewählt ist, dass eine saubere Übungsausführung grundsätzlich möglich ist und sich nicht bereits von Beginn an eine Überforderung einstellt. Dies gilt in besonderem Maße für komplexere Bewegungsabfolgen. Hier lohnt es sich oftmals, eine „Trockenübung“ vorzuschalten, das Erlernen der Technik also voranzustellen und dabei auf Musik zu verzichten, um die Konzentration komplett auf die Ausführung zu lenken. Ist der Bewegungsablauf verinnerlicht, kann wieder dazu übergegangen werden, den Fokus des Trainings auf die Intensität zu legen und dabei auf Unterstützung durch Musik zurückzugreifen.
Die eigene Körperwahrnehmung schulen
Überlastung droht auch dann, wenn die Ablenkung durch die Musik so groß wird, dass die körperlichen Reaktionen aus dem Blick geraten oder übergangen werden. Diesen Effekt habe ich in Indoor Cycling Kursen regelmäßig erlebt. Gerade neue Teilnehmer muss man in solchen Fällen oft eher bremsen als motivieren. Angefeuert durch die Gruppendynamik, treibende Beats und die generelle Atmosphäre geschieht es vor allem bei unerfahrenen Teilnehmern schnell, dass sie sich im Eifer des Gefechts so von den eigenen körperlichen Reaktionen ablenken lassen oder diese bewusst ignorieren, dass sie sich so regelrecht selbst „abschießen“. Glücklicherweise gehen derartige Fälle bei sportgesunden Menschen in der Regel gut aus. Allerdings ist diese Art des „Trainings“ weder sinnvoll noch für die Betroffenen angenehm, gerade wenn es im Anschluss, ausgelöst durch die Überanstrengung, zu Übelkeit, Muskelkrämpfen, nächtlicher Unruhe, etc. kommt. Gerade diejenigen Sportler, die bisher noch wenig Erfahrung mit musikgestütztem Training gemacht haben, sollten diesen Aspekt am Anfang besonders im Auge haben. Denn die Verlockung zu „overpacen“ ist bei dynamischen Playlists mit der eigenen Lieblingsmusik recht hoch. Das anfängliche Hochgefühl und die damit einhergehende Trainingsintensität oder
-geschwindigkeit bezahlt man jedoch häufig damit, die Einheit zu schnell oder zu hart anzugehen und zum Ende hin einen Einbruch zu erleben.
Darüber hinaus ist Training weit mehr als das automatische Abspulen von Bewegungen. Doch leider scheint, wenn man Sportler beim Training beobachtet, immer wieder genau das einzutreten. Egal ob in Gruppenkursen oder auf der Trainingsfläche sieht man regelmäßig Sportler, die mechanisch ihr Programm durchexerzieren und bei denen der Eindruck entsteht, sie seien in Gedanken vollkommen anderswo. Dieser Effekt kann durch Musik verstärkt werden. Ist diese Form der Ausführung eher Standard als die Ausnahme, hat das zur Folge, dass kein oder kaum Bewusstsein dafür entsteht, welche Muskelgruppen bei einer Übung aktiviert bzw. von ihr angesprochen werden sollen.
Ein klassisches Beispiel für diesen Fall: Ich wurde und werde in regelmäßigen Abständen darauf angesprochen, dass trotz regelmäßiger Squats keinerlei Verbesserung hinsichtlich der Gesäßmuskulatur stattfindet. Des Rätsels Lösung besteht meist darin, dass die betreffenden Sportler mit den Squats zwar eine Übung ausführen, von der sie gehört oder gelesen haben, dass sie die gewünschte Muskelgruppe anspricht, diesen Effekt aber nie selbst gespürt haben. Dann wird zum Beispiel vor allem der Vorfuß belastet und die Kraft in erster Linie aus der Muskulatur der Oberschenkelvorderseite geholt. Zudem erfolgt eine Kompensation des nicht oder nicht ausreichend aktivierten Gluteus durch andere Muskelgruppen, die dadurch überlastet werden. Besonders häufig habe ich dieses Phänomen bei Teilnehmern von Gruppenkursen erlebt, die über die Jahre hinweg zwar tausende an Kniebeugen ausgeführt, dabei jedoch keine über die Standardanweisungen hinausgehende technische Einführung erhalten und schon gar kein gezieltes Techniktraining absolviert hatten. In solchen Fällen lohnt es sich selbst bei langjährigen Sportlern, noch einmal zu den „Basics“ zurückzukehren und sie ein Gefühl dafür entwickeln zu lassen, wie sie selbständig einzelne Muskelgruppen ansteuern und aktivieren. Bei diesem Schritt ist die Musik hinderlich und sollte daher weggelassen werden. Gleiches gilt bei Formaten wie bestimmten Yogastilen, die speziell auf die Schulung der Eigenwahrnehmung ausgelegt sind. Auch hier ist Musik dem gewünschten Ergebnis abträglich.
Wettkampfvorbereitung unter realistischen Bedingungen
Wie bereits gezeigt kann Musik motivieren, von der Anstrengung ablenken und so indirekt die Leistung steigern. Das erleichtert eindeutig die ein oder andere harte Trainingseinheit und hilft, im Wettkampf selbst die letzten Kraftreserven zu mobilisieren. Allerdings sollte im Hinblick auf eine Wettkampfvorbereitung im Blick behalten werden, unter welchen Bedingungen die Veranstaltung letztendlich stattfindet. Das klingt trivial, wurde aber für Hobbyathleten bereits zur Herausforderung. So machte 2007 die Entscheidung des Organisationskomitees des New York Marathons Schlagzeilen, Musik bei der Teilnahme künftig zu untersagen. Auch in anderen Disziplinen müssen die Athleten im Wettkampf auf Musikunterstützung verzichten. Genau diese Gegebenheiten sollte in der Vorbereitung berücksichtigt und entsprechend trainiert werden, um Leistungseinbußen im Wettkampf zu vermeiden. Je nach Sportart kann es aber genauso umgekehrt vorkommen, dass Sportler mit einer erheblichen Geräuschkulisse konfrontiert werden, beispielsweise durch Fans und Zuschauer, durch parallel stattfindende Wettkämpfe oder eingespielte Musik. Wer davor ausschließlich mit Hilfe seiner Kopfhörer von der Außenwelt abgeschottet trainiert hat, läuft leichter Gefahr, in der Wettkampfsituation abgelenkt zu werden. Aus offensichtlichen Gründen ist es unmöglich, die tatsächliche Stadion- oder Hallenatmosphäre nachzustellen. Weiß man jedoch im Voraus, dass eine Ablenkung zu erwarten ist, lohnt sich ein Training, bei dem auf zusätzliche Abschottung verzichtet wird und „Störungen“ durch andere Trainierende nicht durch Musik ausgeblendet werden.
Musik sinnvoll eingesetzt – Orientierungshilfen für die Zusammenstellung des eigenen Soundtracks
Es zeigt sich: Training mit Musik hat ganz klar zwei Seiten. Wie in so vielen Fällen gibt es hier nicht die eine Wahrheit oder den einen richtigen Weg. Insbesondere im Breitensport ist deshalb in der Regel ein Mittelweg sinnvoll, das heißt, eine Kombination aus beiden Varianten. Auf diese Weise kann der Sportler die positiven Effekte der Musik nutzen wie etwa Motivation und bessere Stimmung, gleichzeitig aber einen Fokus auf korrekte Ausführung, Technik sowie Verbesserung der Eigenwahrnehmung setzen.
Bei der Zusammenstellung des persönlichen Soundtracks spielen die individuellen Präferenzen eine große Rolle. Darüber hinaus gibt es einige allgemeine Kriterien, die bei der Auswahl helfen können. Hier eine kurze Übersicht von Karageorghis und Priest bezüglich hilfreicher Charakteristika:[13]
- (a) starke, energetisierende Rhythmen
- (b) positive Songtexte mit Bezug zu Bewegung (z. B. “Body Groove” von The Architects Ft. Nana)
- (c) rhythmische Muster, die an die Bewegungsmuster der ausgeübten Sportart angepasst sind
- (d) stimmungsaufhellende Melodien und Harmonien
- (e) Assoziationen mit Sport, Training, Triumph oder dem Überwinden von Hindernissen
- (f) Musikstile und Idiome, die dem individuellen Geschmack des Sportlers entsprechen oder zu seiner kulturellen Sozialisierung passen
- Hinsichtlich des idealen Tempos findet sich bei Karageorghis die Empfehlung, sich auf einen Bereich zwischen 120 und 140 bpm zu konzentrieren. Ab einem Tempo von 145 scheint keine weitere Steigerung der Effektivität mehr vorzuliegen.[14]
Bei diesen Punkten handelt es sich um eine allgemeine Orientierungshilfe. Die tatsächliche Auswahl sollte selbstverständlich nach den eigenen Zielen, Vorlieben und Bedürfnissen ausgerichtet werden![15]
Für Fragen und weiteren Austausch steht die Autorin gerne unter sabine.nunius@sanu-training.com zur Verfügung.
[1] Terry, Peter C., Costas I. Karageorghis, Michelle L. Curran, Olwenn V. Martin, und Renée L. Parsons-Smith. 2020. „Effects of Music in Exercise and Sport: A Meta-Analytic Review“. Psychological Bulletin 146 (2): 91–117. https://doi.org/10.1037/bul0000216.
[2] Juslin PN (2019), Musical Emotions Explained, Oxford University Press.
[3] Lane AM, Davis PA, Devonport TJ. Effects of music interventions on emotional States and running performance. J Sports Sci Med. 2011 Jun 1;10(2):400-7. PMID: 24149889; PMCID: PMC3761862.
[4] Ballmann CG, Favre ML, Phillips MT, Rogers RR, Pederson JA, Williams TD. Effect of Pre-Exercise Music on Bench Press Power, Velocity, and Repetition Volume. Percept Mot Skills. 2021 Jun;128(3):1183-1196. doi: 10.1177/00315125211002406. Epub 2021 Mar 15. PMID: 33722102.
[5] Pates, J., Karageorghis, C. I., Fryer, R., & Maynard, I. (2003). Effects of asynchronous music on flow states and shooting performance among netball players. Psychology of Sport and Exercise, 4(4), 415–427. https://doi.org/10.1016/S1469-0292(02)00039-0
[6] https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/dissoziation/3533, abgeruf. 09.02.2023
[7] Wu, Jianfeng, Lingyan Zhang, Hongchun Yang, Chunfu Lu, Lu Jiang, und Yuyun Chen. 2022. „The Effect of Music Tempo on Fatigue Perception at Different Exercise Intensities“. International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (7): 3869. https://doi.org/10.3390/ijerph19073869.
[8] Chow, Enoch C., und Jennifer L. Etnier. 2017a. „Effects of Music and Video on Perceived Exertion during High-Intensity Exercise“. Journal of Sport and Health Science 6 (1): 81–88. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2015.12.007.
[9] Bartolomei S, Di Michele R, Merni F. EFFECTS OF SELF-SELECTED MUSIC ON MAXIMAL BENCH PRESS STRENGTH AND STRENGTH ENDURANCE. Percept Mot Skills. 2015 Jun;120(3):714-21. doi: 10.2466/06.30.PMS.120v19x9. PMID: 26106802.
[10] Biagini MS, Brown LE, Coburn JW, Judelson DA, Statler TA, Bottaro M, Tran TT, Longo NA. Effects of self-selected music on strength, explosiveness, and mood. J Strength Cond Res. 2012 Jul;26(7):1934-8. doi: 10.1519/JSC.0b013e318237e7b3. PMID: 22033366.
[11] Ballmann CG, Favre ML, Phillips MT, Rogers RR, Pederson JA, Williams TD. Effect of Pre-Exercise Music on Bench Press Power, Velocity, and Repetition Volume. Percept Mot Skills. 2021 Jun;128(3):1183-1196. doi: 10.1177/00315125211002406. Epub 2021 Mar 15. PMID: 33722102.
[12] Trappe, HJ. Musik und Herz. Kardiologe 11, 486–496 (2017). https://doi.org/10.1007/s12181-017-0192-7
[13] Academy, U. S. Sports. 2008. „Music in Sport and Exercise : An Update on Research and Application“. The Sport Journal (blog). 7. Juli 2008. https://thesportjournal.org/article/music-sport-and-exercise-update-research-and-application/.
[14] https://www.nytimes.com/2008/01/10/fashion/10fitness.html, abgeruf. 09.02.2023
[15] Für diejenigen, die tiefer in das Thema einsteigen möchten, eignen sich die Studien und Bücher von Professor Costas I. Karageorghis, der an der Brunel University in London zu diesem Thema forscht.